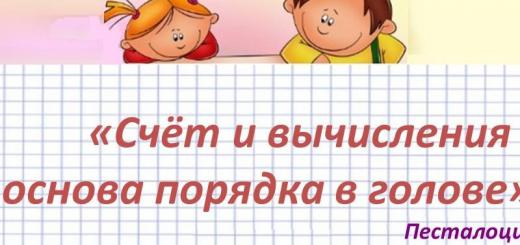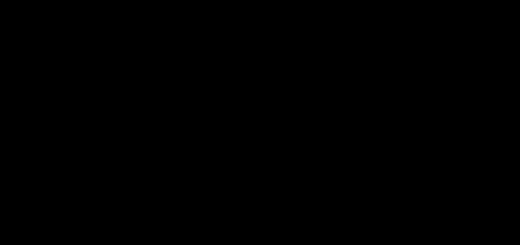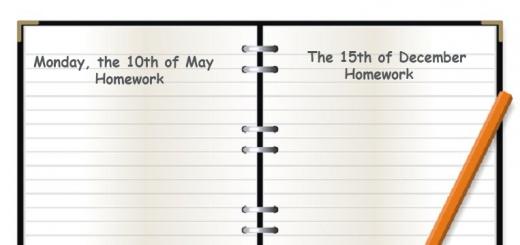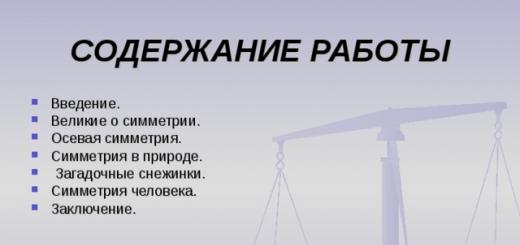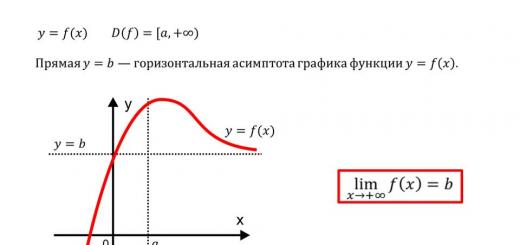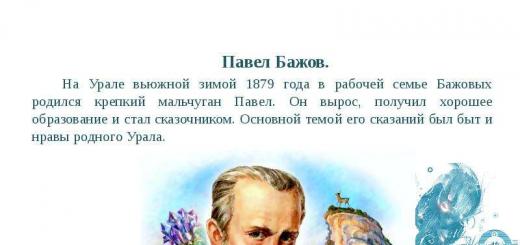Maximilian Aleksandrovich Voloshin (richtiger Name Kiriyenko-Voloshin) wurde am 28. Mai (16. Mai – Old Style) 1877 geboren – russischer symbolistischer Dichter, Kritiker, Essayist, Künstler, Philosoph, einer der klügsten Dichter des Silbernen Zeitalters.
Maximilian Woloschin wurde zu seinen Lebzeiten zur Legende. Mittlerweile ist die Legende zu einem Mythos geworden und von unseren Zeitgenossen praktisch vergessen. Der Sonnenmann, Künstler, Dichter, Bildhauer und Meister Maximilian Alexandrowitsch Woloschin ist jedoch eine echte Figur in der Geschichte der russischen Literatur und der russischen Kunst. Er war der Hüter des „heiligen Handwerks“. Seine Spuren sind nicht nur im Boden der Krim eingeprägt, sondern auch im Boden der russischen Kultur unseres Jahrhunderts: in der Poesie, der Übersetzungskunst, der Prosa, der Malerei, der Kunstgeschichte, der Philosophie.
Von Natur aus großzügig begabt, konnte Maximilian Woloschin alles. Er hatte goldene Hände. Ein Dichter und ein Künstler vereint in Woloschin. Er war ein Meister und sah aus wie ein Nachkomme von einigen alter Stamm starke Männer, Reisende, Künstler. Er hatte etwas Solides, Verlässliches, Solides, Renaissance an sich. Sie suchten Halt in ihm. Woloschin brachte Arbeiter und Schöpfer zusammen, vereinte sie, bildete Cluster und Nester, freute sich über Treffen und trauerte über Nichttreffen. Er glaubte (und blieb bis zu seinem Lebensende in diesem Glauben), dass der Mensch von Geburt an ein Genie sei, dass ihm die Energie der Sonne innewohne. Es gab keinen anderen Meister dieser Art und vielleicht wird es auch nie einen anderen auf russischem Boden geben ...
frühe Jahre
Maximilian Alexandrowitsch wurde in Kiew in der Familie eines Anwalts, des Hochschulberaters Alexander Maksimovich Kirienko-Voloshin (1838–1881) und Elena Ottobaldovna (1850–1923), geborene Glaser, geboren. Mein Vater führte seine Abstammung auf die Saporoschje-Kosaken zurück. Die Vorfahren meiner Mutter waren russifizierte Deutsche, die im 18. Jahrhundert nach Russland kamen. Wie der Dichter selbst glaubte, war er „ein Produkt gemischten Blutes (deutsch, russisch, italienisch-griechisch)“.
Von Kiew zog die Familie Kirienko-Voloshin nach Taganrog. Im Alter von vier Jahren verlor Maximilian seinen Vater und wurde von seiner Mutter großgezogen. Elena Ottobaldovna wollte als aktive und unabhängige Person nicht von den Verwandten ihres Mannes abhängig bleiben. Zusammen mit ihrem vierjährigen Sohn zog sie nach Moskau, wo sie einen Job bekam und selbst Geld verdiente, um Max zu ernähren und großzuziehen. Bis zu seinem 16. Lebensjahr lebte der Junge in Moskau, studierte am 1. Staatsgymnasium, begann Gedichte zu schreiben und beschäftigte sich mit Übersetzungen von Heine.
Im Jahr 1893 verließ Elena Ottobaldovna die Hauptstadt aufgrund finanzieller Schwierigkeiten. Für ein paar Cent kauft sie ein kleines Grundstück auf der Krim, in der Nähe des bulgarischen Dorfes Koktebel. Maximilian und seine Mutter ziehen auf die Krim. Zum ersten Mal in seinem Leben erscheinen Feodosia mit seinen genuesischen Festungen und türkischen Ruinen und Koktebel: das Meer, Wermut, Haufen des alten Karadag-Vulkans. Das ganze Leben des Dichters wird mit Koktebel verbunden sein – dafür hat die Natur selbst gesorgt: Einer der Karadag-Berge ähnelt auffallend dem Profil Woloschins. „Und auf dem Felsen, der die Dünung der Bucht abschloss, formten das Schicksal und die Winde mein Profil ...“ (Gedicht „Koktebel“, 1918).
Das Koktebel-Haus der Woloschins lag sieben Meilen von Feodosia entfernt. Bis zu seinem Abschluss am Gymnasium lebte Maximilian in einer Mietwohnung in der Stadt. In Moskau lernte er äußerst schlecht, erhielt in allen Fächern „Zweien“ und „Einsen“ und blieb das zweite Jahr in derselben Klasse. Woloschin erhielt von den Lehrern niedrige Noten, und zwar nicht aus Mangel an Wissen oder mangelndem Interesse am Lernen, sondern weil er zu viele Fragen stellte, zu „originell“ war und den offiziellen, formellen Ansatz nicht ertragen konnte menschliche Persönlichkeit. Den Memoiren von Elena Ottobaldovna zufolge, die später den Status einer Familienlegende erlangten, zuckte er, als sie Max' Moskauer Zeugnis dem Direktor des Gymnasiums in Feodosia überreichte, verwirrt mit den Schultern und bemerkte: „Wir korrigieren keine Idioten.“ ” Die Moral in der Provinz war jedoch einfacher: Sie achteten auf den fähigen jungen Mann, der hervorragend zeichnete, Gedichte schrieb und über unbestreitbares künstlerisches Talent verfügte. Bald wurde Max fast zu einer lokalen Berühmtheit; man sagte ihm eine große Zukunft voraus und nannte ihn nichts Geringeres als „den zweiten Puschkin“.
Im Jahr 1897 trat Woloschin auf Drängen seiner Mutter in die juristische Fakultät der Moskauer Universität ein. Im Jahr 1899 wurde er wegen seiner aktiven Teilnahme am Allrussischen Studentenstreik für ein Jahr ausgewiesen und unter geheimer Aufsicht der Polizei nach Feodosia deportiert. Am 29. August desselben Jahres reiste er mit seiner Mutter für fast sechs Monate zum ersten Mal ins Ausland nach Europa. Nach Moskau zurückgekehrt, legte Woloschin als externer Student die Prüfungen an der Universität ab, wechselte in das dritte Jahr und begab sich im Mai 1900 erneut auf eine zweimonatige Reise durch Europa auf einer von ihm selbst entwickelten Route. Diesmal - zu Fuß, mit Freunden: Vasily Isheev, Leonid Kandaurov, Alexey Smirnov. Nach seiner Rückkehr nach Russland wurde Maximilian Woloschin wegen des Verdachts der Verbreitung illegaler Literatur verhaftet. Von der Krim wurde er nach Moskau transportiert, wo er zwei Wochen lang in Einzelhaft gehalten wurde, aber bald wieder freigelassen wurde und ihm das Recht auf Einreise nach Moskau und St. Petersburg entzogen wurde. Dies beschleunigte Woloschins Abgang Zentralasien mit einer Vermessungsgruppe für den Bau der Orenburg-Taschkent-Eisenbahn. Damals - ins freiwillige Exil. Im September 1900 wurde eine Umfragegruppe unter der Leitung von V.O. Vyazemsky, kam in Taschkent an. Es umfasst M.A. Woloschin, der in seinem Ausweis als Sanitäter aufgeführt war. Er zeigte jedoch so bemerkenswerte organisatorische Fähigkeiten, dass er beim Aufbruch der Gruppe zur Expedition in die verantwortungsvolle Position des Leiters der Karawane und des Lagerleiters berufen wurde.
„1900, die Wende von zwei Jahrhunderten, war das Jahr meiner spirituellen Geburt. Ich bin mit Karawanen durch die Wüste gelaufen. Hier überholten mich die „Drei Gespräche“ von Nietzsche und Vl. Solovyova. Sie gaben mir die Gelegenheit, die gesamte europäische Kultur rückblickend zu betrachten – von den Höhen der asiatischen Hochebenen aus und die kulturellen Werte neu zu bewerten“, schrieb M. Woloschin über diese Zeit in seinem Leben.
In Taschkent beschließt er, nicht an die Universität zurückzukehren, sondern nach Europa zu gehen und sich selbst weiterzubilden.
Bürger der Welt
Im Jahr 1901 kam M.A. Woloschin zum zweiten Mal nach Paris und verband sein Leben für lange Zeit mit dieser Stadt. Da er keine systematische Ausbildung als Künstler erhalten hat, zeichnet er bereitwillig in Kruglikovas Atelier, studiert Malerei an der Colarossi-Akademie und studiert französische Literatur. Die Bandbreite seiner Interessen erstreckt sich auf alle Erscheinungsformen moderne Kultur Frankreich. Seine Rezensionen französischer Ereignisse und kritische Artikel werden in vielen russischen Zeitschriften veröffentlicht.
In Paris M.A. Woloschin kommuniziert mit französischen Dichtern und Schriftstellern – M. Leclerc, Henri de Regnier, J. Lemaitre, A. Mersereau, O. Mirbeau, E. Verhaeren, G. Apollinaire, R. Gil, A. France, Sadia Levy, M. Maeterlinck , R. Rolland, Künstler - Odilon Redon, Ory Robin, A. Matisse, F. Léger, A. Modigliani, P. Picasso, D. Rivera, Bildhauer - A. Bourdelle, J. Charmois, A. Mayol, sowie - mit T. Garnier, G. Brandes, Hambo Lama von Tibet Agvan Dorzhiev, Theosophen A. Mintslova, A. Besant, G. Olcott, Anthroposoph R. Steiner, Okkultist Papus. 1905 wurde er in die Freimaurer der Großloge von Frankreich aufgenommen und 1908 – in den 2. Freimaurergrad, 1909 – zum Meister erhoben und erhielt die persönliche „Charta ...“.
Schon damals, als sehr junger Mann, entwarf Woloschin ein Lebensprogramm für sich, das auf diesem Wunsch basierte
Der Dichter genießt die Atmosphäre der Hauptstadt Frankreichs, nimmt ihren unbeschreiblichen Geist auf, schreibt Gedichte, die bald den wunderbaren Zyklus „Paris“ bilden werden – eine Art Liebeserklärung an diese Stadt, ein Gefühl der Verschmelzung mit ihr, ein elegisches Lied des Abschieds von der vorbeigehenden Jugend. Über den Platz, den Paris und Frankreich im Leben des Dichters einnahmen, können Sie in den Memoiren Woloschins von M. Zwetajewa lesen:
Im Jahr 1908 schuf der polnische Bildhauer Edward Wittig ein großes skulpturales Porträt von M.A. Woloschin, das im Herbstsalon ausgestellt wurde, wurde vom Pariser Rathaus gekauft und im folgenden Jahr am Exelman Boulevard 66 installiert, wo es bis heute steht.
Woloschin besucht Russland oft, aber nicht nur dort. „Wanderjahre“ heißt der erste Zyklus der ersten Gedichtsammlung des Dichters. Wandern – dieses Wort kann die Anfangsphase seiner Lebensreise beschreiben.
„In diesen Jahren bin ich nur noch ein saugfähiger Schwamm. Ich bin ganz Augen, ganz Ohren. Ich wandere durch Länder, Museen, Bibliotheken: Rom, Spanien, Korsika, Andorra, Louvre, Prado, Vatikan ... Nationalbibliothek. Neben der Worttechnik beherrsche ich die Technik von Pinsel und Bleistift... Stadien der Geisteswanderung: Buddhismus, Katholizismus, Magie, Freimaurerei, Okkultismus, Theosophie, R. Steiner. Eine Zeit großer persönlicher Erlebnisse romantischer und mystischer Natur ...“, schrieb der Künstler 1925 in seiner Autobiographie.
Maximilian Woloschin interessierte sich für alles Neue und Originelle – für Literatur, Kunst, Philosophie, Leben. Korn für Korn sammelte er alles, was seiner Weltanschauung entsprach, was sich dann in seiner außergewöhnlichen Toleranz, visionären Gedichtzeilen, erstaunlichen Aquarellen, originellen kritischen Artikeln und Vorträgen kristallisierte. Da er ein orthodoxer Mensch ist und sich zu den Altgläubigen hingezogen fühlt, sind Woloschin und Alltagsleben und in seiner Kreativität strebte er nach Selbstbeherrschung und Hingabe.
„Du hast gegeben und deshalb bist du reich, aber du bist Sklave von allem, was zu geben schade ist“, sagte er und erkannte das Haus und die Bibliothek als das einzige physische Eigentum an.
„Er hat alles gegeben, er hat allen gegeben“, erinnert sich Marina Zwetajewa.
Margarita Sabashnikova
Trotz seiner äußerlichen Originalität und seines Charmes blieb Maximilian Alexandrowitsch lange Zeit die sogenannte männliche Attraktivität beraubt. Frauen zogen es vor, mit ihm befreundet zu sein, vertrauten ihm als Freund, mehr aber auch nicht. Selbst Elena Ottobaldowna machte sich in ihrer Jugend oft über ihren Sohn lustig: „Was für ein Dichter bist du, wenn du dich noch nie verliebt hast?“ Und einige seiner Freunde gaben zu, dass sie mutig mit ihm ins Badehaus gehen und ihm erlauben würden, sich den Rücken zu waschen, ohne zu glauben, dass diese Tat über die Grenzen des Anstands hinausgeht.
Erst 1903 besuchte in Moskau der berühmte Sammler S.I. Schtschukin Maximilian Alexandrowitsch lernte ein Mädchen kennen, das ihn mit ihrer ungewöhnlichen Schönheit, Raffinesse und originellen Weltanschauung überraschte. Ihr Name war Margarita Vasilievna Sabashnikova. Als Künstlerin der Repin-Schule, ein Fan von Wrubels Werk, in der Künstlerszene als subtile Porträtmalerin und Koloristin sowie als Dichterin der symbolistischen Bewegung bekannt, gewann sie Woloschins Herz. Viele Kritiker bemerkten die „Schwere“ und „Steifheit“ Liebestexte Maximilian Woloschin lobt seine bürgerliche Poesie. Doch in den ersten Jahren seiner Begegnungen mit Margarita Wassiljewna wäre er fast ein Lyriker geworden:
Am 12. April 1906 heirateten Sabashnikova und Woloschin in Moskau. Später blickte Maximilian Alexandrowitsch auf die Vergangenheit zurück und neigte dazu, Margarita Sabashnikova als seine erste und fast einzige Liebe zu betrachten. Nur ihre Ehe war von kurzer Dauer. Zeitgenossen zufolge waren die Ehepartner zu unpassend füreinander: Ihre Weltanschauung erwies sich als anders, der Ton von Margarita Wassiljewna war zu erbaulich. Woloschin, der keinen Unterricht, sondern nur Kameradschaft akzeptiert, versuchte, die Liebe aus dem Alltag zu retten, doch seine Bemühungen waren vergeblich. Schon äußerlich machte das Bündnis zwischen Sabaschnikow und Woloschin einen seltsamen Eindruck. Es ist ein Fall bekannt, in dem Max einmal seine junge Frau nach Koktebel brachte und ein kleines Mädchen, das Elena Ottobaldovna besuchte, verwirrt ausrief: „Mama! Warum hat so eine Prinzessin diesen Hausmeister geheiratet?!“
Ein Jahr später trennte sich das Paar und pflegte bis zum Ende von Woloschins Leben freundschaftliche Beziehungen. Einer der äußeren Gründe war Margarita Wassiljewnas Leidenschaft für Wjatscheslaw Iwanow, mit dem die Woloschins nebenan in St. Petersburg lebten. Aber auch ihre Romanze hat nicht geklappt. Im Jahr 1922 wurde M.V. Woloschina musste Sowjetrussland verlassen. Sie ließ sich im Süden Deutschlands, in Stuttgart nieder, wo sie bis zu ihrem Tod 1976 lebte und sich mit spiritueller Malerei der christlichen und anthroposophischen Richtung beschäftigte.
Haus des Dichters in Koktebel
Im Jahr 1903 begann Maximilian Woloschin mit dem Bau seines eigenen Hauses in Koktebel. Seine Skizzen zum Hausentwurf sind erhalten. Die Innenaufteilung ist einzigartig – 22 kleine Räume sind alle durch Türen miteinander verbunden, sodass Sie beim Betreten des Hauses durch das gesamte Haus gehen können, ohne nach draußen gehen zu müssen. Aber von jedem Zimmer aus gab es eine Tür nach draußen – man konnte sich zurückziehen und wie in einer Zelle leben. Das Haus war ursprünglich für den Komfort der Gäste, für ihre Entspannung, Kreativität und gegenseitige Kommunikation geplant.
Das Haus wurde in zwei Etappen gebaut. Im Jahr 1913 vollendete Woloschin eine Erweiterung des Hauses – eine zweistöckige Werkstatt aus Wildstein mit einem hohen Erkerfenster. Das Gebäude mit unterschiedlichen Rhythmen architektonischer Volumen und Fenster, umgeben von hellblauen Terrassen und Decks, mit einer Turmbrücke erwies sich als überraschend harmonisch und bildete ein einziges Ganzes mit der Koktebel-durchschneidenden Landschaft. Viele Möbelstücke und die Inneneinrichtung des Hauses wurden ebenfalls von Woloschin selbst hergestellt. Derzeit haben sie einen kulturellen, historischen und künstlerischen Wert.
Der Ausdruck „Haus des Dichters“ hat sowohl eine direkte als auch eine übertragene Bedeutung. Dies ist der Wohnsitz, die Werkstatt eines Dichters und Künstlers. Und gleichzeitig erweitert sich das Haus des Dichters um das Konzept der Welt des Dichters.
Woloschins Haus sieht aus wie ein Schiff. So nennen sie es – Schiff. Zufluchtshaus? Nicht nur. Über dem Haus befindet sich ein Turm mit einer Plattform zur Beobachtung der Sterne. Eine Startrampe für den Gedankenflug. Hier spürte der Dichter die Verbindung zwischen Heimat, einer einsamen Seele und der Unermesslichkeit des Universums. Kimmerien wird nicht nur zum physischen Aufenthaltsort Woloschins, zu seinem Wohnort, sondern auch zur wahren Heimat seines Geistes und ersetzt das Wandern, das „Fernweh“.
Hier, inmitten der Wirren der heißen Jahre der Revolution und des Bürgerkriegs, die Tragödien der ersten Jahre Sowjetmacht M.A. Woloschin hat es geschafft, einen einzigartigen Wohn- und Kommunikationsstil zu schaffen, eine Atmosphäre der Gastfreundschaft aufrechtzuerhalten, Hochkultur und wahre Kreativität.
Ein brillanter Schwindel
1907, nach der Trennung von Sobaschnikowa, beschloss Woloschin, nach Koktebel aufzubrechen. Hier schreibt er seinen berühmten Zyklus „Cimmerian Twilight“. Seit 1910 arbeitet er an monografischen Artikeln über K.F. Bogaevsky, A.S. Golubkina, M.S. Saryan, spricht zur Verteidigung Kunstgruppen„Karo-Bube“ und „Eselsschwanz“. Während dieser Zeit verbrachte Woloschin viel Zeit in Koktebel und war damit kein Unbekannter im Leben der St. Petersburger Böhmen: Der „allgegenwärtige“ Max besucht Abende im „Turm“ von Wjatscheslaw Iwanow, kommuniziert aktiv mit symbolistischen Dichtern und nimmt daran teil die Erschaffung des Berühmten Literaturzeitschrift"Apollo".
Im Sommer 1909 kamen die jungen Dichter Nikolai Gumilyov und Elizaveta (Lilya) Dmitrieva, ein hässliches, lahmes, aber sehr talentiertes Mädchen, nach Koktebel, um Woloschin zu besuchen. Im Gegensatz zu Gumilyov und anderen Mitgliedern der Apollo-Redaktion erkannte Maximilian Alexandrowitsch sofort großes Potenzial in der bescheidenen Lila und schaffte es, ihr Vertrauen in die seine einzuflößen kreative Möglichkeiten. Bald schufen Woloschin und Dmitriewa den berühmtesten literarischen Schwindel des 20. Jahrhunderts – Cherubina de Gabriac. Woloschin erfand die Legende, die literarische Maske von Cherubina, und fungierte als Vermittler zwischen Dmitrieva und dem Herausgeber von Apollo S. Makovsky. Nur Lilya schrieb Gedichte.
Am 22. November 1909 kam es am Schwarzen Fluss zu einem Duell zwischen Woloschin und N. Gumilev. In Studien zur Geschichte des Silbernen Zeitalters ist viel über die Gründe für dieses Duell gesagt worden. Laut dem „Geständnis“, das Elizaveta Dmitrieva 1926 (kurz vor ihrem Tod) verfasste, war der Hauptgrund die Unbescheidenheit von N. Gumilyov, der überall über seine Affäre mit Cherubina de Gabriac sprach. Nachdem Woloschin Gumilyov im Atelier des Künstlers Golovin eine öffentliche Ohrfeige gegeben hatte, trat er nicht für seinen literarischen Scherz ein, sondern für die Ehre einer ihm nahestehenden Frau – Elizaveta Dmitrieva. Das skandalöse Duell, in dem Woloschin als Ritter – Verteidiger und „Sklave“ der Ehre – auftrat, brachte Maximilian Alexandrowitsch jedoch nur Spott ein. Da sie Gumilyovs unparteiische Tat ignorierten, neigten Zeitgenossen aus irgendeinem Grund dazu, das Verhalten seines Gegners zu verurteilen: Anstelle einer symbolischen Ohrfeige und einer Herausforderung gab Woloschin Gumilyov auf dem Weg zum Ort des Duells eine echte Ohrfeige verlor seine Galosche und zwang alle, danach zu suchen, dann schoss er grundsätzlich nicht usw. .d. usw.
Allerdings war das Duell der Dichter trotz aller damit verbundenen fantastischen Gerüchte und Anekdoten ein ernstes Duell. Gumilyov schoss zweimal auf Woloschin, verfehlte ihn aber. Woloschin schoss absichtlich in die Luft, und seine Pistole schlug zweimal hintereinander fehl. Alle Teilnehmer des Duells wurden mit einer Geldstrafe von zehn Rubel bestraft. Entgegen Zeitungsberichten schüttelten die Gegner nach dem Kampf weder die Hand noch schlossen sie Frieden. Erst 1921, als er Gumilyov auf der Krim traf, antwortete Woloschin auf seinen Händedruck, aber Gumilyov betrachtete den langjährigen Vorfall nicht als geklärt, und dieses Treffen war für ihn eindeutig unangenehm.
Elizaveta Dmitrieva (Cherubina de Gabriak) verließ Woloschin unmittelbar nach dem Duell und heiratete ihren Freund aus Kindertagen, den Ingenieur Wsewolod Wassiljew. Für den Rest ihres Lebens (bis 1928) war sie wie Maximilian Alexandrowitsch aktives Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft und korrespondierte mit Woloschin.
Woloschin: Dichter, Künstler
Die erste Gedichtsammlung von M. Woloschin „Gedichte. 1900-1910“ erschien 1910 in Moskau, als Woloschin bereits 33 Jahre alt war. Mittlerweile ist er längst zu einer prominenten Figur im literarischen Prozess geworden: ein einflussreicher Kritiker und etablierter Dichter mit dem Ruf eines „strengen Parnassianers“. Im Jahr 1914 erschien ein Buch mit seinen ausgewählten Artikeln zum Thema Kultur, „Faces of Creativity“. und 1915 – ein Buch mit leidenschaftlichen Gedichten über die Schrecken des Krieges – „Anno mundi ardentis 1915“.
In den Jahren 1910-1914 verließ Woloschin Koktebel nur selten. Er widmet sich immer mehr der Malerei, malt Aquarelllandschaften der Krim und stellt seine Werke auf Ausstellungen der World of Art aus.
„... In Woloschins Poesie, in seinem erstaunlichen Pinsel, der die Idee von Koktebel hervorbringt, entdeckte er die gesamte Lebensweise, angefangen bei der Skizze des Hauses, von der Anordnung der Räume, Veranden , Treppen zu den Landschaften des Künstlers, seinen Gemälden, Sammlungen von Kieselsteinen, Fossilien und der besonderen Auswahl an Büchern aus seiner Bibliothek sehen wir Koktebel, kreativ erfahren und daher zum ersten Mal in das Leben der Kultur hineingeboren. Vierzig Jahre kreatives Leben und Denken in Koktebel, Gedanken über Koktebel sind die Kultur des offenbarten Koktebel, verbunden mit den Höhen der westeuropäischen Kultur. ... M.A. erschien in Moskau, mischte sich schnell in die aktuellen Themen ein und fungierte vor allem als Friedensstifter, indem er Widersprüche zwischen Gegnern glättete...; und verschwand dann spurlos oder nach Europa, wo er sozusagen Honig sammelte künstlerische Kultur West oder in seine Heimat Koktebel, wo er in der Einsamkeit alles, was er sah und hörte, in jene neue Qualität verwandelte, die später Woloschins Haus zu einem der kulturellsten Zentren nicht nur in Russland, sondern auch in Europa machte“, schrieb ein Zeitgenosse von Maximilian Woloschin.
Woloschin nannte die ersten Manifestationen der Unzufriedenheit der Bevölkerung zu Beginn des Jahres 1905 „eine Meuterei auf den Knien“. Im Januar dieses Jahres war Woloschin in St. Petersburg. Er schreibt einen Artikel „Blutige Woche in St. Petersburg“, einen Artikel, der einerseits ein Augenzeugenbericht ist und andererseits die Stimmung des Dichters selbst zeigt. Er verstand schon damals, was damals geschah verdammter Januar ist das erste Glied in der Kette von Ereignissen revolutionärer Natur. Der Dichter sah das Ende des Reiches voraus, obwohl er es vielleicht zu pompös und theatralisch ausdrückte. In Prosa klingt es so: „Zuschauer, sei still! Der Vorhang geht auf. In seinen 1905 in St. Petersburg verfassten Gedichten („Foreshadowing“) heißt es:
Der Dichter wird von „Wanderungen des Geistes“ überwältigt; er interessiert sich für Theosophie, Selbsterkenntnis, studiert die Geschichte der Französischen Revolution und denkt weiterhin über das Schicksal seines Vaterlandes nach.
Was ist der Weg der Geschichte? Woloschin weiß es nicht. Aber er lehnt Grausamkeit und Blutvergießen entschieden ab. Krieg, Mord, Terror – diese Mittel sind durch kein Ziel gerechtfertigt und daher für ihn inakzeptabel. Dies ist die Position von Maximilian Woloschin. Sein ganzes Leben lang konnte es die eine oder andere Schattierung annehmen, aber im Wesentlichen blieb er den christlichen Grundsätzen treu, die während des Ersten Weltkriegs besonders stark ausgeprägt waren:
Erster Weltkrieg
Im Juli 1914 reiste Woloschin auf Einladung von M. Sabashnikova in die Schweiz nach Dornach. Vertreter hier verschiedene Länder, vereint um Rudolf Steiner, begann mit dem Bau des Johannisbaus (Goetheanum) – eines anthroposophischen Tempels, der die Einheit der Religionen und Nationen symbolisiert.
Anschließend erinnerte sich Maximilian Alexandrowitsch daran, dass es auf dieser Reise so war, als würde ihn das Schicksal beschützen. Er schaffte es im letzten Moment vor Beginn des Weltmassakers überall hin: Er bestieg den letzten Dampfer, sprang auf die Stufen des letzten Zuges, und hinter ihm schienen alle Türen zuzuschlagen, sodass er nicht mehr umkehren konnte:
Als Milizionär zweiter Klasse, ein völlig gesunder und fähiger Mann, musste Herr Woloschin eingezogen werden. Sein Aufenthalt in der Schweiz, in Frankreich und in Spanien in den Jahren 1914-1916 konnte als Desertion, Umgehung der Bürgerpflichten und den Entzug der russischen Staatsbürgerschaft angesehen werden. Woloschin könnte man als „Weltbürger“ bezeichnen: Sein Werk stand in ständiger Wechselwirkung mit den kulturellen Traditionen vieler Länder und Völker, doch auch das Schicksal seiner Heimat beschäftigte den Dichter leidenschaftlich. Maximilian Alexandrowitsch wollte weder Deserteur noch Emigrant genannt werden und kehrte im Frühjahr 1916 nach Russland zurück. Er appelliert förmlich an den Minister mit einer Ablehnung Militärdienst und bringt seine Bereitschaft zum Ausdruck, dafür jede Strafe zu tragen:
„Ich weigere mich, Soldat zu sein, als Europäer, als Künstler, als Dichter ... Als Dichter habe ich kein Recht, das Schwert zu erheben, da mir das Wort gegeben wurde, und an Zwietracht teilzunehmen , denn meine Pflicht ist Verständnis.“
Für Woloschin ist der Krieg die größte Tragödie der Nationen. Für ihn „gibt es in diesen Tagen weder Feind noch Bruder: Alles ist in mir, und ich bin in jedem.“ Ein Vergleich von Woloschins sozialgeschichtlicher Position mit Tolstois Nicht-Widerstand gegen das Böse durch Gewalt liegt nahe. Natürlich beschränkt sich Tolstois Lehre nicht auf solchen Widerstandslosigkeit; sie ist viel umfassender und ehrgeiziger. In dem Artikel „Das Schicksal von Leo Tolstoi“ (1910) stellt Woloschin fest: „Die Formel für die weltweite Heilung vom Bösen ist einfach: Widerstehen Sie dem Bösen nicht, und das Böse wird Sie nicht berühren.“ Tolstoi hat es konsequent und bis zum Ende durch sein Leben geführt.“ Und weiter – zerknirscht: „Tolstoi verstand die Bedeutung des Bösen auf Erden nicht und konnte seine Geheimnisse nicht lüften.“
Es hat keinen Sinn, Woloschin zu einem Tolstoianer zu machen, aber es ist ganz natürlich, vom Humanismus als dem Anfang zu sprechen, der sie vereint. Nur gibt es Zeiten, in denen eine solche Position in den Augen der Mehrheit nicht nur als absurde Dummheit, sondern teilweise auch als Verbrechen erscheint.
Was genau der Pfarrer auf die Botschaft des Dichters reagierte, ist in keinem der Texte angegeben berühmte Biografien und Autobiografien von M.A. Woloschin. Offensichtlich hatte das russische Kriegsministerium im Jahr 1916 andere Dinge zu tun, als die anthroposophischen Ansichten von Herrn Woloschin zu demontieren und an seinen Patriotismus zu appellieren. Es ist nur bekannt, dass Woloschin am 20. November 1916 durch eine ärztliche Untersuchung aus dem Gefängnis entlassen wurde. Militärdienst und ging nach Koktebel.
Revolution und Bürgerkrieg
Doch bereits 1917, nach der bolschewistischen Revolution, stieß die humanistische Position „über dem Kampf“, die Maximilian Alexandrowitsch einnahm, nicht einmal bei seinen engsten Vertrauten auf Verständnis.
Die Oktoberrevolution sowie die Ereignisse von 1917 im Allgemeinen werden von Woloschin als eine noch größere und ihm am Herzen liegende Katastrophe wahrgenommen als der gesamte vorangegangene Weltkrieg:
Vom 10. bis 25. November 1917 waren der Fähnrich Sergej Jakowlewitsch Efron und seine Frau Marina Zwetajewa in Koktebel. Maximilian Alexandrowitsch und Elena Ottobaldowna pflegten langjährige freundschaftliche Beziehungen zur Familie Zwetajewa-Efron: Sergej und Marina lernten sich in ihrem Haus in Koktebel kennen, Elena Ottobaldowna war die Patin ihrer ältesten Tochter Ariadna Efron und Maximilian war der Anwalt in allen Familienangelegenheiten . Sergej Efron, der am antibolschewistischen Aufstand in Moskau teilnahm, stellte sich eindeutig auf die Seite der Gegner der Sowjetmacht. Von den Woloschins ging er sofort zum Don, um sich der Freiwilligenarmee anzuschließen.
Den Memoiren von M. Tsvetaeva zufolge warf Max in diesen schicksalhaften, entscheidenden Tagen für Russland sogar Max‘ Mutter Max seine demonstrative Untätigkeit vor:
„Schau, Max, Seryozha, das ist ein richtiger Mann! Ehemann. Krieg – Kämpfen. Und du? Was machst du, Max?
Mama, ich kann nicht meine Tunika anziehen und lebende Menschen erschießen, nur weil sie anders denken als ich.
Sie denken, sie denken. Es gibt Zeiten, Max, in denen du nicht nachdenken musst, es aber tun musst. Ohne nachzudenken, tu es.
Solche Zeiten gibt es bei Tieren immer, Mama – das nennt man „tierische Instinkte“.
Nachdem er sich der Autorität von Elena Ottobaldovna widersetzt hat, wählt ein erwachsener 40-jähriger Mann, Woloschin, bewusst die unrentable, absurde Rolle eines Friedensstifters, gerade wenn von einer Versöhnung der Gegner keine Rede sein kann. Einerseits steht er tatsächlich „zwischen einem Felsen und einem harten Ort“, mitten in einem tobenden Element, in dem es für niemanden Gnade gibt:
Und eine Person, die einen solchen Platz in der Geschichte gewählt hat, kann nicht als Feigling bezeichnet werden.
Andererseits ist die Position von Herrn Woloschin während des blutigen Bürgerkriegs ein hervorragendes Beispiel für Menschlichkeit. Indem er sich bewusst weigert, zu den Waffen zu greifen, nimmt er nicht die distanzierte Pose eines außenstehenden Beobachters ein. Der Dichter, Bürger, Mann Woloschin tut ohne nachzudenken alles in seiner Macht stehende, um Menschen zu retten, die im Schmelztiegel des Bürgerkriegs gefangen sind:
Ganz im Gegenteil schwierige Jahre(von 1917 bis 1921) Woloschins Koktebel-Haus war voller Bewohner; im Sommer wohnten bis zu sechshundert Menschen bei gastfreundlichen Gastgebern. Es war ein kostenloser Zufluchtsort für Wissenschaftler, Schriftsteller, Künstler, Künstler und Flieger.
„Diejenigen, die Woloschin damals kannten Bürgerkrieg, dem Regierungswechsel, der mehr als drei Jahre auf der Krim dauerte, erinnerten sie sich richtig daran, wie fremd ihm Hin und Her, Angst und kurzfristiger politischer Enthusiasmus waren. Auf seine Art, aber ebenso hartnäckig wie Leo Tolstoi, widerstand er den Wirbelstürmen der Geschichte, die an die Schwelle seines Hauses schlugen ...“, erinnert sich E. Gertsyk.
Woloschins Haus in Koktebel – das Haus des Dichters – wird für alle zu einer Insel der Wärme und des Lichts. Der Dichter akzeptierte weder den weißen noch den roten Terror und rettete beide: Er gewährte Schutz, fungierte als Verteidiger und Fürsprecher für die Roten vor den Weißen und für die Weißen vor den Roten. Oftmals rettete seine Fürsprache und Teilnahme am Schicksal dieser oder jener Person das Leben einer zum Tode verurteilten Person, wandelte das Gerichtsurteil um und verhinderte die unvermeidliche Zerstörung von Kulturdenkmälern und Kunstwerken.
Im Jahr 1918 gelang es dem Dichter, das Koktebel-Anwesen der Erben von E. A. Junge, in dem viele Kunstwerke und eine seltene Bibliothek aufbewahrt wurden, vor der Zerstörung zu retten. Im Januar 1919 nahm er an der zweiten Konferenz der Taurischen Wissenschaftsvereinigung in Sewastopol teil, die dem Schutz von Kultur- und Naturdenkmälern gewidmet war.
Im Sommer 1919 rettete Woloschin General N.A. Marx, einen prominenten Paläographen und Verfasser der „Legenden der Krim“, vor einem unfairen Prozess gegen die Weißgardisten. Als im Mai 1920 die weiße Spionageabwehr die Untergrundtagung des bolschewistischen Kongresses in Koktebel übernahm, fand einer der Delegierten Zuflucht und Schutz in Woloschins Haus. Ende Juli half Maximilian Alexandrowitsch bei der Freilassung des Dichters O. E. Mandelstam, der von den Weißgardisten verhaftet wurde.
Am 3. Oktober 1920 schrieb Woloschin einen Brief an das Büro des Taurischen Wissenschaftskongresses (in Simferopol), in dem er die Unverletzlichkeit von „Bibliotheken, Gemäldesammlungen, Büros von Wissenschaftlern und Schriftstellern, Künstlerwerkstätten“ in Feodosia forderte. „Und im Militärlager die wenigen Nester, in denen die kreative Arbeit„- ruft er und bittet darum, die Galerie von I. K. Aivazovsky, sein Haus und das Haus von K. F. Bogaevsky, A. M. Petrova, dem Künstler N. I. Khrustachev und dem Astronomen V. K. Tserasky aus Militärquartieren und Requisitionen zu befreien.
Der Erfolg des aktiven Friedensstifters Woloschin erklärt sich aus der Tatsache, dass Maximilian Alexandrowitsch vor niemandem Angst hatte. Er glaubte, dass die besten menschlichen Eigenschaften letztendlich über Wut und Hass siegen würden, dass Liebe und Güte höher seien als Blutvergießen und Streit. Woloschin betonte auf jede erdenkliche Weise seine Unpolitik in den Beziehungen sowohl zu den Roten Kommissaren als auch zu den weißen Militärführern. Seine Zeitgenossen bemerkten mehr als einmal, dass Max allein durch seine Anwesenheit die Streitenden zur Versöhnung zwingen und die zum Schlag erhobene Hand still und leise senken und sogar zum freundlichen Schütteln ausstrecken konnte. Er konnte es sich leisten, zu Verhandlungen an einem öffentlichen Ort ohne Hose, in Tunika und Sandalen auf nackten Füßen zu erscheinen und die Haare mit einem Riemen zusammengebunden zu haben. Und niemand wagte es, es als Pose oder Dummheit zu bezeichnen. Es war, als stünde er „über der Welt“, jenseits von Begriffen wie „offiziell“ oder „anständig“.
Zeitgenossen zufolge hatte Woloschin viele Gesichter, hatte aber keine zwei Gesichter. Wenn er einen Fehler machte, betraf er immer das Leben eines Menschen und nicht seinen Tod: Es gibt kein Recht, keinen Schuldigen, jeder verdient sowohl Mitleid als auch Verurteilung.
Einer Legende zufolge blieb Bela Kun selbst während des Roten Terrors (Ende 1920), als auf der Krim Tausende Menschen erschossen wurden, im Haus des Dichters und erlaubte Woloschin, jede zehnte Person von den Hinrichtungslisten zu streichen. Und Woloschin hat diejenigen durchgestrichen, zu denen er erst gestern mit Bitten um Begnadigung für Gegner des weißen Regimes gegangen war.
Cimmerischer Einsiedler
Trotz der ständigen Probleme im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den Behörden, der Aufrechterhaltung des Anwesens und der Wirtschaft eröffnete Woloschin in den zwanziger Jahren eine große und ernste Phase seines dichterischen Schaffens, schrieb er große Menge wunderschöne kimmerische Aquarelle, über die der Künstler und anspruchsvolle Kritiker Alexandre Benois schrieb:
„Es gibt in der Geschichte der Malerei nicht viele Werke, die nur „echten“ Künstlern gewidmet sind und ähnliche Gedanken und Träume hervorrufen können wie die, die die Improvisationen dieses „Dilettanten“ anregen ...“
Während des Bürgerkriegs schuf Woloschin eine Reihe seiner berühmtesten Gedichte (die Zyklen „Strife“, „Portraits“, die Gedichte „Saint Seraphim“, „Habakuk“, Übersetzungen von A. de Regnier). Sammlungen seiner Gedichte und poetischen Übersetzungen werden in Moskau und Charkow veröffentlicht.
Veresaev stellt eine genaue Diagnose:
„Die Revolution traf seine Kreativität wie Feuerstein auf Feuerstein, und helle, prächtige Funken regneten von ihr herab. Es war, als wäre ein ganz anderer Dichter erschienen, mutig, stark, mit einem einfachen und weisen Wort ...“
„Weder der Krieg noch die Revolution haben mir Angst gemacht oder mich in irgendetwas enttäuscht …“, schrieb Woloschin in seiner Autobiografie von 1925. „Das Prinzip der kommunistischen Wirtschaft passte perfekt zu meiner Abneigung gegen Löhne und gegen Kaufen und Verkaufen.“
Nach der Besetzung der Krim durch die Rote Armee im Jahr 1921 arbeitete Woloschin im Bereich der öffentlichen Bildung. Er wurde zum Leiter des Denkmalschutzes für Kunst und Wissenschaft im Bezirk Feodosia ernannt, nimmt an Kultur- und Bildungsveranstaltungen der Krim-Bildung teil, unterrichtet bei Kommandokursen und an der Volksuniversität.
Im Jahr 1922 verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Maximilian Alexandrowitsch merklich: Er erkrankte an Paläorthritis. Auch Elena Ottobaldowna legte sich zu Bett, nachdem sie den Bürgerkrieg und die Hungersnot auf der Krim überlebt hatte. Sie starb 1923. Nach dem Tod seiner Mutter heiratete M.A. Woloschin offiziell Maria Stepanowna Zabolotskaya, eine Sanitäterin, die ihm in den letzten Jahren ihres Lebens bei der Pflege von Elena Ottobaldowna half.
Vielleicht hat diese Ehe das Leben von Woloschin selbst etwas verlängert. In den verbleibenden zehn Jahren war er häufig krank und verließ die Krim fast nie.
Aber die „sowjetische Realität“ drang hin und wieder in das Leben im Haus des Dichters ein. Der örtliche Dorfrat behandelte Woloschin als Datschabesitzer und „Bourgeois“ und forderte von Zeit zu Zeit seine Räumung aus Koktebel. Die Finanzinspektion konnte nicht glauben, dass der Dichter Zimmer nicht gegen Geld vermietete, und verlangte die Zahlung einer Steuer für „Hotelunterhalt“. Komsomol-Aktivisten stürmten ins Haus, forderten Spenden für Vozdukhoflot und Osoaviakhim und brandmarkten dann Woloschin für seine Weigerung, die sie als „Konterrevolution“ betrachteten ... Immer wieder mussten sie sich an Moskau wenden, Lunatscharski um Fürsprache bitten, Gorki, Enukidze; Sammeln Sie Unterschriften von Gästen für eine „Bescheinigung“ über die freie Verfügbarkeit ihres Hauses...
In einem Brief an L. B. Kamenev im November 1924, in dem er sich an den Parteichef wandte und ihn um Unterstützung bei seinem Vorhaben bat, erklärte Woloschin: „Von Jahr zu Jahr kamen Dichter und Künstler hierher, um mich zu sehen, was eine Art literarische Kultur aus Koktebel (in der Nähe von Feodossija) schuf ). Kunstzentrum. Zu Lebzeiten meiner Mutter wurde das Haus für die Sommermiete hergerichtet, und nach ihrem Tod verwandelte ich es in ein kostenloses Haus für Schriftsteller, Künstler, Wissenschaftler ... Die Türen stehen allen offen, auch denen, die von der Straße kommen .“
Schließlich wurden im Jahr 1925 durch das Dekret des Zentralen Exekutivkomitees der Krim das Haus Woloschins sowie das Haus seiner Mutter, die sich auf demselben Grundstück befanden, Maximilian Alexandrowitsch zugewiesen. Er erhält eine Bescheinigung des Volkskommissars für Bildung A. V. Lunacharsky, die die Einrichtung eines kostenlosen Erholungsheims für Schriftsteller im Koktebel-Haus genehmigt. Das Dichterhaus wird wieder zum Zentrum des kulturellen Lebens des Landes. Allein im Jahr 1925 besuchten fast dreihundert Menschen sein Haus und blieben eine Woche oder einen Monat: Dichter, Künstler, Schriftsteller. Der gesamte hektische Haushalt ruhte auf den Schultern Woloschins und seiner Frau Maria Stepanowna. Maximilian Alexandrowitsch wurde als Mitglied des Schriftstellerverbandes aufgenommen, Ausstellungen seiner künstlerischen Werke finden in Moskau, Charkow, Leningrad statt, er wurde zum Ehrenmitglied der Gesellschaft zum Studium der Krim gewählt, hält Vorträge über Kunstgeschichte, und schreibt Memoiren.
Doch die Zeit des relativen Wohlstands weicht sehr schnell einem „dunklen Streifen“: Seit 1929 hat sich der Gesundheitszustand von Maximilian Woloschin stark verschlechtert. Zusätzlich zur Paläorthritis verschlimmerte sich das Asthma. Der Geisteszustand des Dichters wurde durch ein gesteigertes Gespür für das Geschehen im Land geprägt – die nahenden Dreißiger machten sich immer deutlicher bemerkbar, immer häufiger kamen Nachrichten über Verhaftungen und Todesfälle von Bekannten. Lokale Behörden waren bereit, ihre Entscheidung bezüglich Woloschins Besitz des Dichterhauses in Koktebel zu ändern und den Künstler einer sozialistischen „Verdichtung“ zu unterwerfen. Aus Sorge um das Schicksal des Hauses, das nicht nur weggenommen, sondern auch einer Umstrukturierung unterzogen werden konnte, die im Wesentlichen die Lieblingsidee des Künstlers zerstörte, erlitt Woloschin am 9. Dezember 1929 einen Schlaganfall.
Im Jahr 1931 verzichtete M. A. Woloschin auf den Besitz des Grundstücks und übergab das Haus seiner Mutter und den ersten Stock seines Hauses an den Allrussischen Verband sowjetischer Schriftsteller, um dort ein kreatives Haus zu errichten. Haus von M.A. Woloschin wurde zum Gebäude Nr. 1 und das Haus von E.O. Kirijenko-Woloschina – Gebäude Nr. 2 des VSSP-Hauses der Kreativität.
Augenzeugen zufolge war Woloschins Geisteszustand im letzten Jahr seines Lebens schrecklich. Die Liebe zum Menschen, von der er in den Jahren des blutigen russischen Massakers lebte und gerettet wurde, rettete den Dichter selbst nicht. Im Sommer 1931 brach auf der Krim und in der gesamten Ukraine eine schreckliche Hungersnot aus, die durch Zwangskollektivierung und Völkermord der Behörden am eigenen Volk verursacht wurde. Menschlichkeit konnte nicht mit Unmenschlichkeit kombiniert werden und wurde daher als Ideologie abgeschafft, die dem Proletariat, dem Sozialismus stalinistischer Prägung fremd war und im Widerspruch zum Geist des diktatorischen Regimes stand. In dieser kalkulierten und gefilterten Wahrnehmung künstlerischer Werte war für Woloschins Poesie kein Platz. Als der Dichter spürt, wie ihm der letzte Boden, der ihn gehalten hat, unter den Füßen verschwindet, beginnt er über eine Methode des Selbstmordes nachzudenken. Er neigt dazu, sich „selbst zu erschießen“ – um ein paar wahrheitsgetreue Gedichte über „ der aktuelle Augenblick", sagen Sie, was immer Sie für notwendig halten, und sterben Sie. Ich hatte nicht mehr die Kraft, „gegen den Strom“ zu rudern.
Im Sommer 1932 erkrankte Maximilian Alexandrowitsch Woloschin an einer Lungenentzündung, ließ sich nicht behandeln und starb am 11. August 1932 im Alter von 56 Jahren. Nach seinem Willen wurde der Dichter auf dem Berg Kutschuk-Jenischary (später Woloschinskaja genannt) beigesetzt. „Auf dem Gipfel des Karadag befindet sich das Grab eines mohammedanischen Heiligen, und auf diesem Gipfel befindet sich das Grab von Woloschin, einem russischen Heiligen“, sagten einheimische Tataren über ihn.
Erinnerung
Das Haus Maximilian Woloschin – das Haus des Dichters – spielte auch nach dem Weggang des Besitzers weiterhin eine bedeutende Rolle im kulturellen und literarischen Prozess des 20. Jahrhunderts. Als Symbol für Freidenken und Kreativität lockte es die kreative Intelligenz nach Koktebel. IN andere Zeit Die berühmtesten Persönlichkeiten aus Kultur und Wissenschaft arbeiteten und ruhten im Haus des Dichters: N. Gumilyov, V. Bryusov, S. Solovyov, V. Khodasevich, O. Mandelstam, M. und A. Tsvetaev, G. Shengeli, K . Chukovsky, I. Erenburg, A. Tolstoi, M. Bulgakov, M. Gorki, V. Veresaev, A. Gabrichevsky, N. Zamyatin, L. Leonov, M. Prishvin, K. Paustovsky, K. Trenev, A. Tvardovsky , I. Brodsky, V Aksenov, K. Petrov-Vodkin, B. Kustodiev, V. Polenov, St. Richter und viele andere.
Bis 1976 lebte seine Witwe Maria Stepanowna Woloschina (Zabolotskaja) im zweiten und dritten Stock des Hauses von M.A. Woloschin. Sie bewahrte die Gedenkausstattung der Räume Maximilian Alexandrowitschs und bewahrte das Haus des Dichters, seine Bibliothek und sein Archiv.
Der Name Maximilian Woloschin wurde von den offiziellen Behörden bis 1977 verschwiegen, als es ihnen anlässlich des 100. Geburtstags des Dichters gelang, mit großen Kosten einen kleinen Band seiner Gedichte zu veröffentlichen. Fast sechzig Jahre lang wurden seine Gedichte im kulturellen Umfeld handschriftlich abgeschrieben und auf der Schreibmaschine nachgeschrieben; seltene Ausstellungen seiner Aquarelle stießen auf großes Interesse.
Auf Wunsch von M.S. Woloschina im Jahr 1975 begannen die Arbeiten zur Schaffung des Museums, und erst am 1. August 1984 wurde das Hausmuseum von M.A. eröffnet. Woloschina öffnete seine Türen weit für Besucher. Dies war ein weiterer kleiner Sieg der Kultur über die Ideologie.
Hausmuseum von M.A. Woloschin ist heute eines der einzigartigsten Museen, das die Authentizität der Sammlung in einem Gedenkgebäude bewahrt hat. Fast alle Möbel im Haus werden von den Händen des Besitzers gefertigt und sind ein Kunstwerk mit Gemälden, Intarsien und Einbrennarbeiten. Das Haus ist gefüllt mit Gegenständen, Büchern und Raritäten, die gekauft, gespendet oder aus dem Ausland mitgebracht wurden. Durch den Willen des Schicksals und die Bemühungen vieler Menschen wurden all diese Dinge an den von ihrem Besitzer ein Jahrhundert zuvor bestimmten Orten aufbewahrt und bilden heute zusammen mit dem Archiv und dem künstlerischen Erbe von Maximilian Woloschin die nummerierte Bestandssammlung des Museums mehr als 55.000 Artikel. Für Europa, das mehr als einen Krieg erlebt hat, ist dies der Fall ein seltenes Phänomen in der Museumswelt.
Maximilian Alexandrowitsch Woloschin(Geburtsname -Kirijenko-Woloschin; 16. Mai 1877, Kiew, Russisches Reich – 11. August 1932, Koktebel, Krim-ASSR, RSFSR, UdSSR) – russischer Dichter, Übersetzer , Landschaftskünstler, Künstler und Literaturkritiker.
Maximilian Kiriyenko-Voloshin (geboren am 16. (28) Mai 1877 in Kiew, in der Familie eines Anwalts und Hochschulberaters).
Bald nach der Geburt ihres Sohnes trennten sich Woloschins Eltern; Maximilian blieb bei seiner Mutter Elena Ottobaldowna (geb. Glaser, 1850–1923); mit ihr pflegte der Dichter bis zu ihrem Lebensende eine familiäre und schöpferische Beziehung. Maximilians Vater starb 1881.
Die frühe Kindheit verbrachte er in Taganrog und Sewastopol.
Woloschin begann seine weiterführende Ausbildung am 1. Moskauer Gymnasium.
Als er und seine Mutter 1893 nach Koktebel auf der Krim zogen, besuchte Maximilian das Feodosia-Gymnasium (das Gebäude ist erhalten geblieben, heute beherbergt es das Staatliche Finanz- und Wirtschaftsinstitut Feodosia (FSFEI)). Der Fußweg von Koktebel nach Feodosia führt etwa sieben Kilometer durch bergiges Wüstengebiet, daher lebte Woloschin in Mietwohnungen in Feodosia.
Von 1897 bis 1899 studierte Maximilian an der Moskauer Universität, wurde „wegen Teilnahme an Unruhen“ mit dem Recht auf Wiedereinstellung ausgewiesen, setzte sein Studium nicht fort und begann mit der Autodidaktik. In den 1900er Jahren reiste er viel, studierte in europäischen Bibliotheken und hörte Vorlesungen an der Sorbonne. In Paris nahm er außerdem Zeichen- und Gravurunterricht bei der Künstlerin E. S. Kruglikova.
Als er Anfang 1903 nach Moskau zurückkehrte, wurde er unter den Russen schnell „einer der Seinen“. Symbolisten; beginnt aktiv zu veröffentlichen. Von da an lebte er abwechselnd in seiner Heimat und in Paris und tat viel dafür, russische und französische Kunst einander näher zu bringen; Seit 1904 versendet er von Paris aus regelmäßig Korrespondenz für die Zeitung „Rus“ und die Zeitschrift „Scales“ und schreibt für die französische Presse über Russland.
Am 23. März 1905 wurde er in Paris Freimaurer, nachdem er in die Freimaurerloge „Werk und wahre wahre Freunde“ Nr. 137 (VLF) aufgenommen worden war. Im April desselben Jahres zog er in die Mount Sinai Lodge Nr. 6 (VLF).
Im April 1906 heiratete er die Künstlerin Margarita Wassiljewna Sabaschnikowa und ließ sich mit ihr in St. Petersburg nieder. Ihre komplexe Beziehung spiegelte sich in vielen Werken Woloschins wider.
Im Jahr 1907 beschloss Woloschin, nach Koktebel aufzubrechen. Schreibt die Serie „Cimmerian Twilight“. Seit 1910 arbeitet er an monografischen Artikeln über K. F. Bogaevsky, A. S. Golubkina, M. S. Saryan und setzt sich für die Künstlergruppen „Jack of Diamonds“ und „Donkey’s Tail“ ein (obwohl er selbst außerhalb der literarischen und künstlerischen Gruppen steht).
Am 22. November 1909 kam es am Schwarzen Fluss zu einem Duell zwischen Woloschin und N. Gumilyov. Evgeniy Znosko-Borovsky wurde Gumilyovs Stellvertreter. Woloschins Stellvertreter war Graf Alexej Tolstoi. Der Grund für das Duell war die Dichterin Elizaveta Dmitrieva, mit der Woloschin einen sehr erfolgreichen literarischen Scherz verfasste – Cherubina de Gabriac. Er bat sie um eine Petition für den Beitritt zur Anthroposophischen Gesellschaft; ihre Korrespondenz dauerte sein ganzes Leben lang, bis zu Dmitrievas Tod im Jahr 1928.
Die erste Sammlung „Gedichte. 1900-1910“ erschien 1910 in Moskau, als Woloschin zu einer prominenten Figur im literarischen Prozess wurde: ein einflussreicher Kritiker und etablierter Dichter mit dem Ruf eines „strengen Parnassianers“. Im Jahr 1914 wurde ein Buch mit ausgewählten Artikeln über Kultur, „Faces of Creativity“, veröffentlicht; 1915 – ein Buch mit leidenschaftlichen Gedichten über die Schrecken des Krieges – „Anno mundi ardentis 1915“ („Im Jahr der brennenden Welt 1915“). Zu dieser Zeit widmete er sich immer mehr der Malerei, malte Aquarelllandschaften der Krim und stellte seine Werke auf Ausstellungen der World of Art aus.
Am 13. Februar 1913 hielt Woloschin im Polytechnischen Museum einen öffentlichen Vortrag „Über den künstlerischen Wert von Repins beschädigtem Gemälde“. In dem Vortrag brachte er zum Ausdruck, dass im Gemälde selbst „selbstzerstörerische Kräfte lauern“ und dass es sein Inhalt und seine künstlerische Form seien, die die Aggression gegen das Gemälde auslösten.
Im Sommer 1914 kam Woloschin, fasziniert von den Ideen der Anthroposophie, nach Dornach (Schweiz), wo er zusammen mit Gleichgesinnten aus mehr als 70 Ländern (darunter Andrei Bely, Asya Turgeneva, Margarita Woloschina usw.) begann der Bau des Goetheanums – der Johanneskirche, Symbol der Brüderlichkeit der Völker und Religionen .
Im Jahr 1914 schrieb Woloschin einen Brief an den russischen Kriegsminister Suchomlinow, in dem er den Militärdienst und die Teilnahme „am blutigen Massaker“ des Ersten Weltkriegs verweigerte.
Nach der Revolution ließ sich Maximilian Woloschin schließlich in Koktebel nieder, in einem Haus, das zwischen 1903 und 1913 von seiner Mutter Elena Ottobaldowna Woloschin erbaut wurde. Hier schuf er viele Aquarelle, die seine „Koktebel Suite“ bildeten. M. Woloschin signiert seine Aquarelle oft mit den Worten: „Ihr feuchtes Licht und Ihre matten Schatten verleihen den Steinen einen Türkiston“ (über den Mond); „Dünn geschnitzte Distanzen, verwaschen vom Licht der Wolken“; „In der Safrandämmerung, lila Hügel“... Diese Inschriften geben einen Eindruck von den Aquarellen des Künstlers – poetisch, perfekt zum Ausdruck bringen nicht so sehr die reale Landschaft als vielmehr die Stimmung, die sie hervorruft, die endlose, unermüdliche Vielfalt der Linien das hügelige „Land Cimmeria“, seine sanften, gedämpften Farben, die Linie des Meeres, der Horizont – eine Art Hexerei, ein Strich, der alles organisiert, Wolken, die am aschefarbenen Mondhimmel schmelzen. Dies erlaubt uns, diese harmonischen Landschaften der kimmerischen Malschule zuzuordnen.
Während des Bürgerkriegs versuchte der Dichter, die Feindseligkeit zu mildern, indem er die Verfolgten in seinem Haus rettete: zuerst die Roten vor den Weißen, dann, nach dem Machtwechsel, die Weißen vor den Roten. Der Brief von M. Woloschin zur Verteidigung des von den Weißen verhafteten O. E. Mandelstam rettete ihn höchstwahrscheinlich vor der Hinrichtung.
Im Jahr 1924 verwandelte Woloschin mit Zustimmung des Volkskommissariats für Bildung sein Haus in Koktebel in ein freies Haus der Kreativität (später das Haus der Kreativität des Literaturfonds der UdSSR).
Am 9. März 1927 wurde die Ehe von Maximilian Woloschin mit Maria Stepanowna Zabolotskaya (1887–1976) eingetragen, die als Ehefrau des Dichters die schwierigen Jahre mit ihm (1922–1932) teilte und seine Stütze war. Nach dem Tod des Dichters gelang es ihr, sein kreatives Erbe und das „Haus des Dichters“ selbst zu bewahren ein leuchtendes Beispiel Zivilcourage.
Woloschin starb nach einem zweiten Schlaganfall am 11. August 1932 in Koktebel und wurde auf dem Berg Kuchuk-Yanyshar in der Nähe von Koktebel begraben. Woloschin vermachte sein Haus dem Schriftstellerverband.
Das Werk Maximilian Alexandrowitschs war und ist sehr beliebt. Zu den Menschen, die von seinen Werken beeinflusst wurden, gehörten Zhukovsky, Anufrieva und viele andere.
Literaturverzeichnis
- Woloschin M. Autobiographie. // Erinnerungen an Maximilian Woloschin. — Sammlung, vgl. Kupchenko V.P., Davydov Z.D. - M., sowjetischer Schriftsteller, 1990 - 720 S.
- Woloschin M.Über mich. // Erinnerungen an Maximilian Woloschin. — Sammlung, vgl. Kupchenko V.P., Davydov Z.D. - M., sowjetischer Schriftsteller, 1990 - 720 S.
- Woloschin M. Gedichte. 1900—1910 / Frontispiz und Figuren. im Text von K. F. Bogaevsky; Region A. Arnshtam. - M.: Grif, 1910. - 128 S.
- „Gesichter der Kreativität“ (1914)
- Woloschin M. Anno mundi ardentis. 1915 / Region L. Baksta. - M.: Zerna, 1916. - 70 S.
- Woloschin M. Iverni: (Ausgewählte Gedichte) / Region. S. Chekhonina (Kunstbibliothek „Kreativität“. N 9-10) - M.: Kreativität, 1918. - 136 S.
- Woloschin M. Taube und stumme Dämonen / Abb., Kopfbedeckungen und Vorderseite. Autor; Porträt Dichter der Region K. A. Shervashidze. - Charkow: Kamena, 1919. - 62 S.
- Woloschin M. Streit: Gedichte über die Revolution. - Lemberg: Lebendiges Wort, 1923. - 24 S.
- Woloschin M. Gedichte über Terror / Region. L. Golubev-Porphyrogenitus. - Berlin: Schriftstellerbuch in Berlin, 1923. - 72 S.
- Woloschin M. Taube und stumme Dämonen / Region. IV. Puni. Ed. 2. - Berlin: Schriftstellerbuch in Berlin, 1923. - 74 S.
- Woloschin M. Die Wege Russlands: Gedichte / Ed. und mit einem Vorwort. Vyach. Zavalishina. - Regensburg: Echo, 1946. - 62 S.
- Maximilian Woloschin ist Künstler. Materialsammlung. - M.: Sowjetischer Künstler, 1976. - 240 S. krank.
Malerarbeiten
- "Spanien. Am Meer“ (1914)
- "Paris. Place de la Concorde bei Nacht“ (1914)
- „Zwei Bäume im Tal. Koktebel“ (1921)
- „Landschaft mit See und Bergen“ (1921)
- „Rosa Dämmerung“ (1925)
- „Von der Hitze ausgedörrte Hügel“ (1925)
- „Mondwirbel“ (1926)
- „Bleilicht“ (1926)
Ein Foto des Dichters, aufgenommen in Odessa vom Fotografen Maslov.
Maximilian Alexandrowitsch Woloschin (bürgerlicher Name Kirienko-Woloschin) ist Dichter, Übersetzer, Literaturkritiker, Essayist, Kunstkritiker und Künstler.
Maximilian verbrachte seine Kindheit in Moskau, wo die Familie von 1881 bis 1893 lebte. Gleichzeitig verfasste er seine ersten Gedichte.
1893 zog die Familie auf die Krim. Maximilians Mutter kaufte ein Grundstück in Koktebel, wo die Familie dauerhaft lebte.
Im Jahr 1897 absolvierte Maximilian ein Gymnasium in der Stadt Feodosia. Im selben Jahr zog M. Woloschin nach Moskau und trat in die juristische Fakultät der Universität ein.
Im Jahr 1903 erfolgte die erste Veröffentlichung der Gedichte von M.A. Woloschin.
Die erste und einzige Aufnahme von M. Woloschins Gedichtlesung entstand im April 1924 (M. Woloschin las zwei Gedichte: „Der brennende Dornbusch“ und „Jeden Tag wird es immer stiller und leiser“).
„Mit dem Kopf des Zeus und dem Körper eines Bären“ – so gab Valentin Kataev unfreundlich, aber wahrheitsgemäß eine Vorstellung von Maximilian Woloschins Aussehen. Es gab so einen ästhetischen, durchschnittlichen Sybariten-Dichter, der aus der Zeit herausfiel und von fast allen vergessen wurde. Zu seiner Zeit predigte er modische Wahrheiten, wie Moses, der vom Sinai herabkam. Übrig bleibt ein Haus – so etwas wie ein Museum, und ein für Urlauber attraktives Grab, in das man statt Blumen üblicherweise seltsame Meereskiesel mitbringt. Ja, es gab eine gut organisierte offizielle Vergessenheit; Woloschin wurde in der UdSSR jahrzehntelang nicht veröffentlicht, weil er nicht in den gut geplanten literarischen Rahmen passte. Aber alle kamen, die „Pilger“ gingen zu seinem Haus in Koktebel und kopierten dort Gedichte, die im Einklang mit seiner Seele standen, aus vier umfangreichen, maschinengeschriebenen, in Leinwand gebundenen Sammlungen.
 Porträt von M. Woloschin von A. Golovin
Porträt von M. Woloschin von A. Golovin
Heute ist das Silberne Zeitalter ohne Woloschin nicht mehr vollständig; seine Gedichtsammlungen und Prosabände werden veröffentlicht, Aquarelle und Memoiren werden veröffentlicht, und das nicht nur in seiner Heimat. Im Jahr 1984 veröffentlichte der französische Verlag „YMCA-PRESS“ fast volle Sitzung Gedichte und Gedichte mit ausführlichem Kommentar. Heute (Juni-Juli 2010) wurde im Rahmen des „Frankreich-Russland“-Jahres die Ausstellung „Woloschin in Paris“ auf dem Sulpice-Platz in der französischen Hauptstadt eröffnet. Und das ist durchaus verständlich – Woloschin betrachtete Paris als seine geistige Heimat, lebte dort mehrmals und lange. Es wird angenommen, dass russische Museen Woloschin eine wunderbare Sammlung neuer französischer Kunst verdanken, da der Sammler und Philanthrop Sergej Schtschukin seinem Geschmack, seiner Gelehrsamkeit und seiner Einsicht vertraute. Woloschins Gelehrsamkeit und seine Kontakte waren immens. Er kommunizierte mit Balmont, Bely, Benois, Bryusov, Blok, Merezhkovsky, Meyerhold, Stanislavsky, Gumilev, Tsvetaeva, Surikov, Saryan. Fügen wir Modigliani, Verhaeren, Maeterlinck, Rodin, Steiner hinzu. Seine Porträts wurden von so berühmten Zeitgenossen wie Golovin, Ostroumova-Lebedeva, Vereisky, Kruglikova, Petrov-Vodkin und Diego Rivera geschaffen. Seit hundert Jahren schmückt eine Ecke von Paris ein skulpturales Porträt des Dichters von Edward Wittig. Woloschin war jedoch nicht nur Dichter, sondern auch Übersetzer, Literaturkritiker, Essayist, Kunstkritiker und natürlich Künstler. Er schien sich für alles auf der Welt zu interessieren, von Archäologie und Geographie bis hin zu Magie, Okkultismus, Freimaurerei und Theosophie. Er besaß eine riesige Bibliothek:
 Porträt von Woloschin von D. Rivera. Paris, 1916
Porträt von Woloschin von D. Rivera. Paris, 1916
Bücherregale ragen wie eine Wand in die Höhe.
Hier reden sie nachts mit mir
Historiker, Dichter, Theologen.
Der Weltkrieg und die Revolution zerstörten die Vorstellungen früherer und gewohnter Werte. „Unsere Zeit ist an Neurasthenie erkrankt“, erklärte Woloschin, der in seiner eigenen künstlerischen und poetischen Welt Robinson blieb und von hoher Moral und Humanismus durchdrungen war. Aber auch der anspruchslose Dichter musste über eine Möglichkeit nachdenken, zu überleben. „Ich beschloss, nach Odessa zu gehen, um Vorträge zu halten, in der Hoffnung, Geld zu verdienen. Ich hatte Tsetlins in Odessa, die mich zu sich riefen.“
Und so kam Woloschin Ende Januar des chaotischen Jahres 1919 in unsere Stadt und wohnte mit seinen Pariser Freunden Maria und Michail Zetlin in Neschinskaja, 36. „Ich kam nach Odessa als letzte Konzentration der russischen Kultur und des intellektuellen Lebens.“ Dies war die letzte Station vor dem Großen Exodus. Vor dem Hintergrund einer bunten Intervention, Arbeitslosigkeit, Typhus und halber Hungersnot wurde die Stadt mit Flüchtlingen aus der Sowjetrepublik überschwemmt: Industrielle, Finanziers, Beamte, Spekulanten, regelrechtes Banditentum blühten, aber gleichzeitig brodelte das kulturelle Leben . A. Tolstoi, E. Kuzmina-Karavaeva, Teffi, G. Shengeli, I. Bunin, V. Doroshevich, T. Shchepkina-Kupernik, A. Vertinsky, I. Kremer waren hier. I. Poddubny sprach. Dutzende Zeitungen und Zeitschriften wurden veröffentlicht. Adalis, Bagritsky, Bisk, Grossman, Inber, Kataev, Shishova, Fioletov, Olesha, Babajan versammelten sich zu literarischen Abenden.
Woloschin liest Gedichte bei Versammlungen und Clubs, nimmt an Debatten teil, berichtet in den literarisch-künstlerischen und religiös-philosophischen Gesellschaften, veröffentlicht in der Presse, spricht in der „Oral Newspaper“ des Journalistenverbandes und bereitet eine Sammlung seiner Übersetzungen vor E. Verhaeren für den Verlag „Omphalos“ Er übersetzt auch „begeistert“ A. de Regnier und kommuniziert freundlich mit jungen Dichtern aus Odessa. Y. Olesha schreibt: „Er behandelte uns junge Dichter herablassend<...>Er las hervorragend Gedichte<...>Mit wem sympathisierte er? Was wollte er für seine Heimat? Er hat diese Fragen damals nicht beantwortet.“ Woloschins Antworten waren jedoch: „Ein Mensch ist mir wichtiger als seine Überzeugungen“ und „Ich habe den Anspruch, der Autor meines eigenen Gesellschaftssystems zu sein.“
 Selbstporträt, 1919
Selbstporträt, 1919
In der hartnäckigen Erinnerung an Bunin ist Woloschin von 1919 wie folgt erhalten geblieben: „... er spricht mit größtem Eifer und viel, er strahlt vor Geselligkeit, Wohlwollen gegenüber allem und jedem, Freude an jedem und an allem – nicht nur.“ von dem, was ihn in diesem hellen, überfüllten und warmen Speisesaal umgibt, aber auch von all den riesigen und schrecklichen Dingen, die auf der Welt im Allgemeinen und im dunklen, schrecklichen Odessa im Besonderen passieren, schon kurz vor der Ankunft des Bolschewiki. Gleichzeitig war er sehr schlecht gekleidet – seine braune Samtbluse, seine schwarzen Hosen und seine kaputten Schuhe glänzten so sehr<...>Er litt damals in großer Not.“ In den Sammlungen des Koktebel-Hausmuseums wurde ein Foto des Dichters gefunden, das der Fotograf Maslov in Odessa aufgenommen hatte.
Am Tag der Ankunft der Bolschewiki, dem 4. April, begleitete Woloschin Alexei Tolstoi in die Emigration, doch er selbst weigerte sich zu gehen und erklärte: „... wenn eine Mutter krank ist, bleiben ihre Kinder bei ihr.“ Der 1. Mai rückte näher und Woloschin beschloss, sich an der festlichen Dekoration der Stadt zu beteiligen und bot an, die Straßen mit farbigen Bannern zu schmücken geometrische Formen und poetischen Zitaten widerrief die neue Regierung jedoch seine Veröffentlichungen in der sozialrevolutionären Presse und entfernte ihn aus dem Künstlerteam.
 Porträt von Woloschin von G. Vereisky
Porträt von Woloschin von G. Vereisky
Ich wollte nach Hause, nach Koktebel. Woloschin nutzt seine Bekanntschaft mit dem Vorsitzenden der Odessaer Tscheka und erhält die Erlaubnis, auf die Krim zu reisen. Aber wie? Ein Mann mit einer unglaublichen Biografie, Konteradmiral Alexander Nemitz, kommt zur Rettung und teilt die einzige verfügbare Eiche „Kosak“ mit drei Matrosen-Tschekisten zu, die angeblich geschickt wurden, um mit Sewastopol zu kommunizieren.
Und dahinter ist die Stadt,
Alles in roter Raserei
Verschüttete Banner
Alles voller Wut und Angst,
Kälte der Gerüchte, Zittern der Erwartungen,
Gequält von Hunger, Pest, Blut,
Wo der Spätfrühling heimlich dahingleitet
In transparenter Spitze aus Akazien und Blumen...
Die vier Segeltage verliefen unruhig, das Meer wurde von französischen Zerstörern blockiert und einer der Offiziere landete auf einer verdächtigen Eiche. Woloschin sprach ohne Dolmetscher mit ihm, stellte sich als Flüchtling vor, und nebenbei stellte sich heraus, dass er gemeinsame Bekannte in Paris hatte, und im Großen und Ganzen lief alles gut. Das kleine Boot erreichte die Küste der Krim, wo es zunächst mit Maschinengewehren beschossen wurde. Und Woloschin übersetzte für Henri de Regnier.
Hausmuseum von M. Woloschin in Koktebel
Es sind viele Eindrücke über die außergewöhnliche Persönlichkeit des Dichters und Künstlers geblieben. Er begeisterte und überraschte nicht nur seine Freunde, sondern sogar seine Feinde. Es ist lustig, dass einige von Woloschins Zügen aus der Zeit des Bürgerkriegs in Professor Maxim Gornostaev aus Konstantin Trenevs sehr revolutionärem Stück „Yarovaya Love“ aus der Mitte der 1920er Jahre zu erkennen sind. Er lebt auf der Krim, tauchte aber auch in Odessa auf. Die sowjetischen Behörden gewährten ihm sicheres Geleit für sein Haus und seine Bücher. Charaktereigenschaften Aussehen - Bart und wilde Frisur. Seine Frau nennt ihn „Max“. Daher ist der mutige revolutionäre Seemann Shvandya überzeugt, dass es sich entweder um Karl Marx oder im Extremfall um seinen handelt jüngerer Bruder. Eine von Gornostaevs Bemerkungen enthielt das folgende Woloschin-Motiv: „Der Mensch arbeitet seit Zehntausenden von Jahren. Er entwickelte sich von einem Halbtier zu einem Halbgott. Er kroch auf allen Vieren aus der Höhle und flog nun in den Himmel. Seine Stimme ist Tausende von Kilometern entfernt zu hören. Ist das ein Mann oder ein Gott? Es stellt sich heraus, dass alles ein Geist ist. Wir sind die gleichen Halbbestien.“
Grab von M.A. Woloschin in Koktebel. Die Fotos wurden von S. Kalmykov im Abstand von 45 Jahren aufgenommen.
 Porträt von Woloschin von Petrow-Wodkin
Porträt von Woloschin von Petrow-Wodkin
Gehört der einzigartige Dichter und Künstler also nur der Vergangenheit an? Urteile selbst. In Odessa 2002-2003. Unter der Schirmherrschaft des World Club of Odessans wurden zwei erstaunliche Bücher veröffentlicht – eine Nachdruckausgabe der seltenen Gedichtsammlung „Ark“ (Feodosia, 1920) mit einem Gedicht von Woloschin und seinem wunderschön veröffentlichten Gedicht „Saint Seraphim“. Die Gedenktafel wurde in Kiew angebracht, wo Maximilian Woloschin geboren wurde. Vor kurzem wurde ihm in Koktebel ein Denkmal errichtet.
Woloschin vermachte sein Haus dem Schriftstellerverband.
Sergey Kalmykov, Lokalhistoriker
Maximilian Woloschin, Dichter, Künstler, Literaturkritiker und Kunstkritiker. Sein Vater, Rechtsanwalt und Hochschulberater Alexander Kirijenko-Woloschin, stammte aus einer Familie von Saporoschje-Kosaken, seine Mutter, Elena Glazer, stammte aus russifizierten deutschen Adligen.
Woloschin verbrachte seine Kindheit in Taganrog. Der Vater starb, als der Junge vier Jahre alt war, und Mutter und Sohn zogen nach Moskau.
„Das Ende der Adoleszenz wird durch die Turnhalle vergiftet““, schrieb der Dichter, der mit seinem Studium nicht zufrieden war. Aber er widmete sich mit Begeisterung dem Lesen. Zuerst Puschkin, Lermontow, Nekrassow, Gogol und Dostojewski, später Byron und Edgar Allan Poe.
Im Jahr 1893 kaufte Woloschins Mutter ein kleines Grundstück im tatarisch-bulgarischen Dorf Koktebel und schickte ihren 16-jährigen Sohn in ein Gymnasium in Feodosia. Woloschin verliebte sich in die Krim und trug dieses Gefühl sein ganzes Leben lang.
Im Jahr 1897 trat Maximilian Woloschin auf Drängen seiner Mutter an die juristische Fakultät der Moskauer Universität ein, studierte jedoch nicht lange. Nachdem er sich dem Allrussischen Studentenstreik angeschlossen hatte, wurde er 1899 vom Unterricht suspendiert „negative Weltanschauung und Propagandaaktivitäten“ und wurde nach Feodosia geschickt.
„Mein Familienname ist Kirienko-Voloshin und kommt aus Zaporozhye. Von Kostomarow weiß ich, dass es im 16. Jahrhundert in der Ukraine einen blinden Banduraspieler gab, Matvey Woloschin, der von den Polen wegen politischer Lieder bei lebendigem Leib gehäutet wurde, und aus Frantsevas Memoiren weiß ich, dass er mit Nachnamen hieß junger Mann Die Person, die Puschkin ins Zigeunerlager brachte, war Kirijenko-Woloschin. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie meine Vorfahren wären.
Autobiographie von Maximilian Woloschin. 1925
In den nächsten zwei Jahren unternahm Woloschin mehrere Reisen nach Europa. Er besuchte Wien, Italien, die Schweiz, Paris, Griechenland und Konstantinopel. Gleichzeitig änderte er seine Meinung über die Rückkehr an die Universität und beschloss, sich autodidaktisch weiterzubilden. Wanderungen und ein unstillbarer Wissensdurst über die Welt um uns herum wurden zum Motor, durch den alle Facetten von Woloschins Talent offenbart wurden.
Alles sehen, alles verstehen, alles wissen, alles erleben
Nehmen Sie alle Formen, alle Farben mit Ihren Augen auf,
Gehe mit brennenden Füßen über die ganze Erde,
Alles wahrnehmen und wieder verkörpern.
Er studierte Literatur in den besten europäischen Bibliotheken, hörte Vorlesungen an der Sorbonne und besuchte Zeichenkurse im Pariser Atelier der Künstlerin Elizaveta Kruglikova. Übrigens entschied er sich für die Malerei, um die Arbeit anderer professionell beurteilen zu können. Insgesamt verbrachte er von 1901 bis 1916 Auslandsaufenthalte, abwechselnd in Europa und auf der Krim.
Am meisten liebte er Paris, wo er oft war. In diesem Mekka der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts kommunizierte Woloschin mit dem Dichter Guillaume Apollinaire, den Schriftstellern Anatole France, Maurice Maeterlinck und Romain Rolland, den Künstlern Henri Matisse, Francois Léger, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Diego Rivera, den Bildhauern Emile Antoine Bourdelle und Aristide Maillol. Der autodidaktische Intellektuelle überraschte seine Zeitgenossen mit seiner Vielseitigkeit. Zu Hause gelangte er problemlos in den Kreis der symbolistischen Dichter und Avantgarde-Künstler. Im Jahr 1903 begann Woloschin nach seinem eigenen Entwurf mit dem Bau eines Hauses in Koktebel.
„...Koktebel ist nicht sofort in meine Seele eingedrungen: Ich habe es nach und nach als die wahre Heimat meines Geistes erkannt. Und ich habe viele Jahre lang an den Küsten des Mittelmeers entlanggewandert, um seine Schönheit und Einzigartigkeit zu verstehen ...“
Maximilian Woloschin
1910 erschien die erste Sammlung seiner Gedichte. 1915 – der zweite – über die Schrecken des Krieges. Er akzeptierte den Ersten Weltkrieg nicht, ebenso wie er später die Revolution – das „kosmische Drama der Existenz“ – nicht akzeptierte. IN Soviet Russland Seine „Iveria“ (1918) und „Deaf and Mute Demons“ (1919) wurden veröffentlicht. Im Jahr 1923 begann die offizielle Verfolgung des Dichters und die Veröffentlichung wurde eingestellt.
Von 1928 bis 1961 wurde in der UdSSR keine einzige Zeile von ihm veröffentlicht. Aber neben Gedichtsammlungen enthielt das kreative Gepäck des Kritikers Woloschin 36 Artikel über russische Literatur, 28 – über Französisch, 35 – über russisches und französisches Theater, 49 – über Ereignisse im französischen Kulturleben, 34 Artikel über russische bildende Kunst und 37 – über Kunst Frankreich.
Nach der Revolution lebte Woloschin dauerhaft auf der Krim. 1924 schuf er das „Haus des Dichters“, dessen Aussehen sowohl an eine mittelalterliche Burg als auch an eine mediterrane Villa erinnert. Die Tsvetaeva-Schwestern, Nikolai Gumilyov, Sergei Solovyov, Korney Chukovsky, Osip Mandelstam, Andrei Bely, Valery Bryusov, Alexander Green, Alexei Tolstoi, Ilya Erenburg, Vladislav Chodasevich, die Künstler Vasily Polenov, Anna Ostroumova-Lebedeva, Kuzma Petrov-Vodkin, Boris haben waren hier Kustodiev, Pjotr Konchalovsky, Aristarkh Lentulov, Alexander Benois...
Maximilian Woloschin. Krim. In der Nähe von Koktebel. 1910er Jahre
Auf der Krim kam Woloschins Begabung als Künstler erst richtig zum Vorschein. Der autodidaktische Maler erwies sich als talentierter Aquarellist. Allerdings malte er seine Cimmeria nicht nach dem Leben, sondern nach seiner eigenen Methode des fertigen Bildes, dank derer unter seinem Pinsel Ansichten der Krim hervorkamen, die in Form und Licht makellos waren. „Die Landschaft sollte Land darstellen, auf dem man laufen kann, - sagte Woloschin, - und der Himmel, durch den man fliegen kann, also in den Landschaften... man soll die Luft spüren, die man tief einatmen möchte...“

Maximilian Woloschin. Koktebel. Sonnenuntergang. 1928
„Fast alle seine Aquarelle sind der Krim gewidmet. Aber das ist nicht die Krim, die jede Fotokamera fotografieren kann, sondern eine Art idealisierte, synthetische Krim, deren Elemente er um sich herum fand, nach Belieben kombinierte und dabei genau das betonte, was in der Nähe von Feodosia zum Vergleich führt mit Hellas, mit Thebaid, mit einigen Orten in Spanien und überhaupt mit allem, in dem sich die Schönheit des Steinskeletts unseres Planeten besonders offenbart.“
Kunstkritiker und Künstler Alexander Benois
Maximilian Woloschin war ein Fan japanischer Gravuren. Nach dem Vorbild der japanischen Klassiker Katsushika Hokusai und Kitagawa Utamaro signierte er seine Aquarelle mit Zeilen eigener Gedichte. Jede Farbe hatte für ihn eine besondere symbolische Bedeutung: Rot steht für Erde, Lehm, Fleisch, Blut und Leidenschaft; Blau – Luft und Geist, Gedanke, Unendlichkeit und das Unbekannte; Gelb – Sonne, Licht, Wille, Selbstbewusstsein; Lila ist die Farbe des Gebets und des Geheimnisses; Grün – das Pflanzenreich, Hoffnung und Lebensfreude.
Biografie
WOLOSHIN, MAXIMILIAN ALEXANDROVICH (Pseud.; richtiger Nachname Kirienko-Woloschin) (1877–1932), russischer Dichter, Künstler, Literaturkritiker, Kunstkritiker. Geboren am 16. (28) Mai 1877 in Kiew, seine väterlichen Vorfahren waren Saporoschje-Kosaken, seine mütterlichen Vorfahren wurden im 17. Jahrhundert russifiziert. Deutsche. Im Alter von drei Jahren blieb er ohne Vater und verbrachte seine Kindheit und Jugend in Moskau. 1893 kaufte seine Mutter ein Grundstück in Koktebel (in der Nähe von Feodosia), wo Woloschin 1897 sein Abitur machte. Nach seinem Eintritt in die juristische Fakultät der Moskauer Universität beteiligte er sich an revolutionären Aktivitäten und wurde wegen seiner Beteiligung am Allrussischen Studentenstreik (Februar 1900) sowie wegen seiner „negativen Weltanschauung“ und „Neigung zu“ vom Unterricht suspendiert alle Arten von Aufregung.“ Um weitere Konsequenzen zu vermeiden, ging er im Herbst 1900 als Arbeiter zum Bau der Taschkent-Orenburg-Eisenbahn. Woloschin nannte diese Zeit später „den entscheidenden Moment in meinem spirituellen Leben“. Hier spürte ich Asien, den Osten, die Antike, die Relativität der europäischen Kultur.“
Dennoch ist es gerade die aktive Beteiligung an den Errungenschaften der künstlerischen und intellektuellen Kultur Westeuropas, die zu ihm wird Lebensziel beginnend mit den ersten Reisen 1899–1900 nach Frankreich, Italien, Österreich-Ungarn, Deutschland, Schweiz, Griechenland. Besonders angezogen fühlte er sich von Paris, wo er das Zentrum des europäischen und damit universellen Geisteslebens sah. Aus Asien zurückgekehrt und aus Angst vor weiterer Verfolgung beschließt Woloschin, „in den Westen zu gehen und die lateinische Disziplin der Form zu durchlaufen“.
Woloschin lebt von April 1901 bis Januar 1903, von Dezember 1903 bis Juni 1906, von Mai 1908 bis Januar 1909, von September 1911 bis Januar 1912 und von Januar 1915 bis April 1916 in Paris. Dazwischen wandert er „innerhalb der antiken Mittelmeerwelt“. „In beiden Fällen kommt es zu Razzien Russische Hauptstädte und lebt in seinem Koktebel „Haus des Dichters“, das zu einer Art wird Kulturzentrum, ein Zufluchtsort und Ruheort für die literarische Elite, „Kimmerisches Athen“, in den Worten des Dichters und Übersetzers G. Shengeli. Zu verschiedenen Zeiten besuchten V. Bryusov, Andrei Bely, M. Gorki, A. Tolstoi, N. Gumilev, M. Tsvetaeva, O. Mandelstam, G. Ivanov, E. Zamyatin, V. Khodasevich, M. Bulgakov, K dort. Tschukowski und viele andere Schriftsteller, Künstler, Schauspieler, Wissenschaftler.
Woloschin debütierte als Literaturkritiker: 1899 veröffentlichte die Zeitschrift „Russischer Gedanke“ seine kleinen Rezensionen ohne Unterschrift, im Mai 1900 erschien dort ein großer Artikel in „Verteidigung Hauptmanns“, signiert „Max. Woloschin“ und stellt eines der ersten russischen Manifeste modernistischer Ästhetik dar. Seine weiteren Artikel (36 über russische Literatur, 28 über französische, 35 über russisches und französisches Theater, 49 über Ereignisse im kulturellen Leben Frankreichs) verkünden und bekräftigen die künstlerischen Prinzipien der Moderne, stellen neue Phänomene der russischen Literatur vor (insbesondere das Werk von „jüngere“ Symbolisten ) im Kontext der modernen europäischen Kultur. „Woloschin wurde in diesen Jahren gebraucht“, erinnert sich Andrei Bely, „ohne ihn, den Allrounder scharfe Kanten, ich weiß nicht, wie die Schärfung der Meinungen enden würde …“ F. Sologub nannte ihn „den Fragesteller dieses Jahrhunderts“, und er wurde auch als „Dichter-Antworter“ bezeichnet. Er war Literaturagent, Experte und Anwalt, Unternehmer und Berater für die Verlage Scorpion, Grif und die Brüder Sabashnikov. Woloschin selbst nannte seinen Bildungsauftrag wie folgt: „Buddhismus, Katholizismus, Magie, Freimaurerei, Okkultismus, Theosophie ...“. All dies wurde durch das Prisma der Kunst wahrgenommen – „die Poesie der Ideen und das Pathos des Denkens“ wurden besonders geschätzt; Daher wurden „Artikel ähnlich wie Gedichte, Gedichte ähnlich wie Artikel“ geschrieben (gemäß der Bemerkung von I. Ehrenburg, der Woloschin einen Aufsatz in dem Buch „Porträts“ widmete moderne Dichter(1923). Zunächst wurden nur wenige Gedichte geschrieben, und fast alle davon wurden in dem Buch „Gedichte“ gesammelt. 1900–1910 (1910). Der Rezensent V. Bryusov sah darin „die Hand eines echten Meisters“, eines „Juweliers“; Woloschin betrachtete seine Lehrer als Virtuosen der poetischen Plastizität (im Gegensatz zur „musikalischen“, Verlaine-Bewegung) T. Gautier, J. M. Heredia und andere französische „parnassische“ Dichter. Dieses Selbstmerkmal lässt sich auf die erste und zweite, unveröffentlichte (in den frühen 1920er Jahren zusammengestellte) Sammlung Selva oscura zurückführen, die Gedichte aus den Jahren 1910–1914 enthielt: Die meisten davon wurden in das Buch des ausgewählten Iverni (1916) aufgenommen. Woloschins klarer poetischer Bezugspunkt ist seit Beginn des Ersten Weltkriegs E. Verhaerne, dessen Übersetzungen von Bryusov in dem Artikel Emil Verhaerne und Valery Bryusov (1907), den er selbst „in“ übersetzte, heftiger Kritik ausgesetzt waren verschiedene Epochen und aus verschiedenen Blickwinkeln“ und die Haltung dazu wurde in dem Buch von Verhaeren zusammengefasst. Schicksal. Schaffung. Übersetzungen (1919). Die Gedichte über den Krieg, aus denen sich die Sammlung Anno mundi ardentis 1915 (1916) zusammensetzt, stehen im Einklang mit Verhaerens Poetik. Hier wurden die Techniken und Bilder dieser poetischen Rhetorik erarbeitet, die während der Revolution, des Bürgerkriegs und der folgenden Jahre zu einem stabilen Merkmal von Woloschins Poesie wurde. Einige der damaligen Gedichte wurden in der Sammlung Deaf and Mute Demons (1919) veröffentlicht, andere unter dem konventionellen einheitlichen Titel Poems about Terror, der 1923 in Berlin erschien; aber zum größten Teil blieben sie im Manuskript. In den 1920er Jahren fasste Woloschin sie in den Büchern „Der brennende Dornbusch“ zusammen. Gedichte über Krieg und Revolution und die Wege Kains. Tragödie materielle Kultur . Doch 1923 begann die offizielle Verfolgung Woloschins, sein Name geriet in Vergessenheit und von 1928 bis 1961 erschien in der UdSSR keine einzige Zeile von ihm in der Presse. Als Ehrenburg 1961 Woloschin in seinen Memoiren respektvoll erwähnte, löste dies eine sofortige Zurechtweisung von A. Dymshits aus, der darauf hinwies: „Herr Woloschin war einer der unbedeutendsten Dekadenten, er ... reagierte negativ auf die Revolution.“ Woloschin kehrte im Frühjahr 1917 auf die Krim zurück. „Ich verlasse sie nicht mehr“, schrieb er in seiner Autobiografie (1925), „ich rette mich vor niemandem, ich wandere nirgendwohin aus ...“ „Da ich mich nicht auf einer der kämpfenden Seiten befinde“, erklärte er zuvor, „lebe ich nur in Russland und was dort passiert … ich (das weiß ich) muss bis zum Ende in Russland bleiben.“ Sein Haus in Koktebel blieb während des gesamten Bürgerkriegs gastfreundlich: „Sowohl der rote Anführer als auch der weiße Offizier“ fanden darin Zuflucht und versteckten sich sogar vor der Verfolgung, wie er in dem Gedicht „Haus des Dichters“ (1926) schrieb. Der „Rote Anführer“ war Bela Kun, der nach der Niederlage von Wrangel die Befriedung der Krim durch Terror und organisierte Hungersnot anführte. Anscheinend wurde Woloschins Haus als Belohnung für seine Unterbringung unter sowjetischer Herrschaft erhalten und für relative Sicherheit gesorgt. Aber weder diese Verdienste noch die Bemühungen des einflussreichen V. Veresaev, noch der flehende und teilweise reuige Appell an den allmächtigen Ideologen L. Kamenev (1924) verhalfen ihm zur Drucklegung. „Gedichte bleiben für mich die einzige Möglichkeit, Gedanken auszudrücken“, schrieb Woloschin. Seine Gedanken gingen in zwei Richtungen: historiosophisch (Gedichte über das Schicksal Russlands, die oft einen bedingt religiösen Unterton annehmen) und antihistorisch (der Zyklus „Die Wege Kains“, durchdrungen von den Ideen des universellen Anarchismus: „Da formuliere ich fast alles.“ meine sozialen Vorstellungen, überwiegend negativ. Der allgemeine Ton ist ironisch“). Die für Woloschin charakteristische Widersprüchlichkeit der Gedanken führte oft dazu, dass seine Gedichte als gestelzte melodische Deklamation (Holy Rus', Transsubstantiation, Angel of the Times, Kitezh, Wild Field), prätentiöse Stilisierung (Das Märchen vom Mönch Epiphanius, Saint) wahrgenommen wurden Seraphim, Erzpriester Avvakum, Demetrius der Kaiser) oder ästhetisierte Spekulationen (Tanob, Leviathan, Kosmos und einige andere Gedichte aus dem Zyklus Auf den Wegen Kains). Dennoch wurden viele Gedichte Woloschins aus der Revolutionszeit als genaue und prägnante poetische Beweise anerkannt (typologische Porträts der Roten Garde, des Spekulanten, des Bürgertums usw., ein poetisches Tagebuch des Roten Terrors, das rhetorische Meisterwerk Nordosten und ähnliche lyrische Erklärungen). als Bereitschaft und Am Ende der Hölle). Woloschins Tätigkeit als Kunstkritiker hörte nach der Revolution auf, es gelang ihm jedoch, 34 Artikel über russische bildende Kunst und 37 über französische Kunst zu veröffentlichen. Sein erstes monografisches Werk über Surikow ist nach wie vor bedeutsam. Das Buch „Der Geist der Gotik“, an dem Woloschin 1912–1913 arbeitete, blieb unvollendet. Woloschin begann mit der Malerei, um die bildenden Künste professionell beurteilen zu können, und erwies sich als begabter Künstler; sein Lieblingsgenre waren Aquarelle von Krimlandschaften mit poetischen Inschriften. Woloschin starb am 11. August 1932 in Koktebel.
Maximilian Alexandrowitsch Woloschin (bürgerlicher Name Kirienko-Woloschin) (1877–1932) – russischer Dichter, Künstler, Literaturkritiker und Kunstkritiker. Er stammt ursprünglich aus Kiew. Im Alter von 3 Jahren verlor er seinen Vater. Seine Mutter kaufte 1893 Land in Koktebel, sodass der Junge 1897 das örtliche Gymnasium studierte und abschloss. Während seines Anwaltsstudiums an der Moskauer Universität schloss er sich den Revolutionären an, weshalb er vom Studium ausgeschlossen wurde. Um weiteren Repressionen zu entgehen, begann er 1900 mit dem Bau der Taschkent-Orenburg-Eisenbahn. Hier kam es zu einem Wendepunkt in der Weltanschauung des jungen Mannes.
Zahlreiche Reisen durch Europa mit häufigen Stopps in seinem geliebten Paris wechseln sich mit Besuchen in Moskau, St. Petersburg und Koktebel ab. Was Letzteres betrifft, so wird Woloschins Haus zum „Haus des Dichters“, in dem sich nicht nur die literarische Elite, sondern auch kreative Menschen versammeln.
Seit 1899 veröffentlicht Woloschin kritische Artikel zur Unterstützung des Modernismus. Woloschin hatte zunächst wenig Poesie. Alles wurde in die Sammlung „Gedichte 1900–1910 (1910)“ aufgenommen. Viele Kreationen blieben unveröffentlicht. Aber V. Bryusov hat es geschafft, Talent zu erkennen.
Seit 1923 ist Woloschin eine Persona non grata. In keiner Printpublikation die Sowjetunion Von 1928 bis 1961 gibt es kein Wort über Woloschin. Der Schriftsteller kehrte 1917 auf die Krim zurück und blieb in seinem „Dichterhaus“, wo er verschiedene in Ungnade gefallene Freunde und Kameraden empfing. Woloschins Poesie dieser Zeit ist entweder allgemein anarchisch oder historiosophisch. Als Kunstkritiker nach der Revolution war Woloschin erschöpft. Allerdings gelang es ihm, 71 Artikel über die schönen Künste Russlands und Frankreichs zu veröffentlichen. Die Surikov gewidmete Monographie ist ein sehr bedeutendes Werk. Woloschin arbeitete zwischen 1912 und 1913 an dem Werk „Der Geist der Gotik“, vollendete es jedoch nie. Woloschin beschloss, Bilder zu malen, um in die Welt der bildenden Kunst einzutauchen, und erwies sich als recht talentierter Künstler. Er liebte es, Landschaften der Krim zu malen und darauf poetische Inschriften zu hinterlassen. Der Schriftsteller starb im August 1932 in Koktebel.