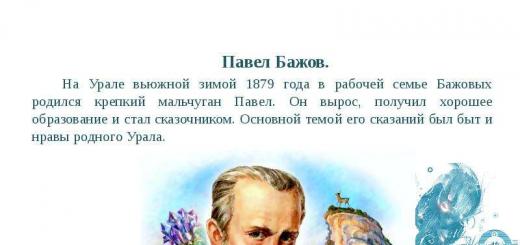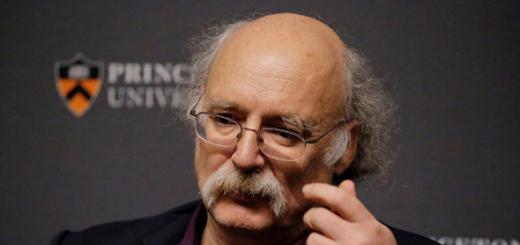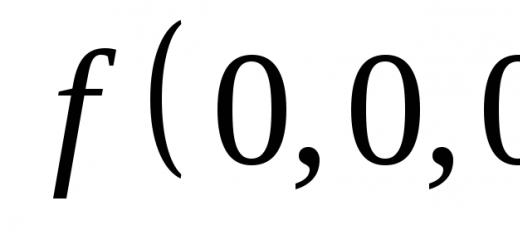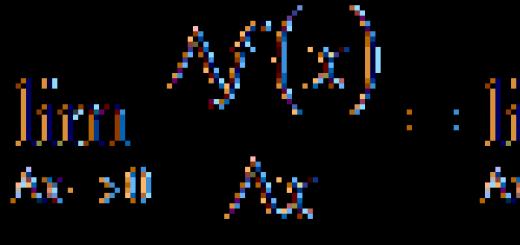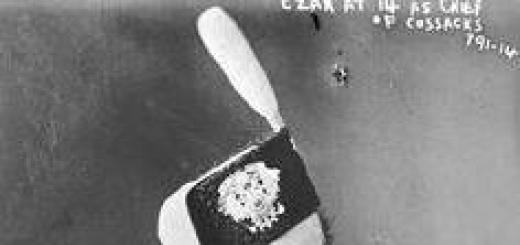Das Rückenmark zeichnet sich durch eine ausgeprägte Segmentstruktur aus, die die Segmentstruktur des Körpers von Wirbeltieren widerspiegelt. Aus jedem Wirbelsäulensegment entspringen zwei Paare ventraler und dorsaler Wurzeln. Rückenwurzeln bilden afferente Eingänge Rückenmark. Sie werden durch die zentralen Fortsätze der Fasern primärer afferenter Neuronen gebildet, deren Körper an die Peripherie geführt werden und sich in den Spinalganglien befinden. Die ventralen Wurzeln bilden die efferenten Ausgänge des Rückenmarks. Die Axone der a- und g-Motoneuronen sowie präganglionäre Neuronen des autonomen Nervensystems nervöses System. Diese Verteilung afferenter und efferenter Fasern wurde zu Beginn des letzten Jahrhunderts festgestellt und als Bell-Magendie-Gesetz bezeichnet. Nach dem Schneiden der Vorderwurzeln auf einer Seite wird ein vollständiges Abschalten der motorischen Reaktionen beobachtet; aber die Empfindlichkeit dieser Körperseite bleibt bestehen. Die Durchtrennung der Rückenwurzeln schaltet die Sensibilität aus, führt aber nicht zum Verlust der motorischen Reaktionen der Muskulatur.
1 - weiße Substanz;
2 - graue Substanz;
3 - hintere (empfindliche) Wurzel;
4 - Spinalnerven;
5 - vordere (motorische) Wurzel;
6 - Spinalganglion
Neuronen der Spinalganglien gehören zu einfachen unipolaren oder pseudounipolaren Neuronen. Der Name „pseudounipolar“ erklärt sich aus der Tatsache, dass in der Embryonalperiode die primären afferenten Neuronen aus bipolaren Zellen entstehen, deren Fortsätze dann verschmelzen. Neuronen der Spinalganglien können in kleine und große Zellen unterteilt werden. Der Körper großer Neuronen hat einen Durchmesser von etwa 60–120 μm, während er bei kleinen Neuronen zwischen 14 und 30 μm liegt.
Aus großen Neuronen entstehen dicke myelinisierte Fasern. Sowohl dünne myelinisierte als auch nichtmyelinisierte Fasern beginnen bei kleinen Fasern. Nach der Bifurkation sind beide Prozesse in entgegengesetzte Richtungen gerichtet: Der zentrale dringt in die Rückenwurzel und als Teil davon in das Rückenmark ein, der periphere in verschiedene somatische und viszerale Nerven und nähert sich den Rezeptorformationen der Haut, Muskeln usw innere Organe.
Manchmal dringen die zentralen Prozesse primärer afferenter Neuronen in die ventrale Wurzel ein. Dies geschieht, wenn sich das Axon des primären afferenten Neurons verdreifacht, wodurch seine Fortsätze in das Rückenmark und durch die dorsalen und ventralen Wurzeln projiziert werden.
Von der gesamten Population dorsaler Ganglienzellen sind etwa 60–70 % kleine Neuronen. Dies entspricht der Tatsache, dass die Anzahl der nicht myelinisierten Fasern in der Rückenwurzel die Anzahl der myelinisierten Fasern übersteigt.
Die Zellkörper dorsaler Ganglienneuronen haben keine dendritischen Fortsätze und empfangen keine synaptischen Eingaben. Ihre Erregung erfolgt durch das Eintreffen eines Aktionspotentials entlang des peripheren Prozesses in Kontakt mit den Rezeptoren.
Zellen der Rückenganglien enthalten hohe Konzentrationen an Glutaminsäure, einem der mutmaßlichen Mediatoren. Ihre Oberflächenmembran enthält Rezeptoren, die speziell auf g-Aminobuttersäure reagieren, was mit der hohen Empfindlichkeit der zentralen Enden der primären afferenten Fasern gegenüber g-Aminobuttersäure zusammenfällt. Kleine Ganglionneuronen enthalten Substanz P oder Somatostatin. Bei beiden Polypeptiden handelt es sich wahrscheinlich auch um Überträger, die von den Enden primärer afferenter Fasern freigesetzt werden.
Jedes Wurzelpaar entspricht einem der Wirbel und verlässt den Wirbelkanal durch das Foramen zwischen ihnen. Daher werden Rückenmarkssegmente üblicherweise durch den Wirbel bezeichnet, in dessen Nähe die entsprechenden Wurzeln aus dem Rückenmark austreten. Auch das Rückenmark ist üblicherweise in mehrere Abschnitte unterteilt: Hals-, Brust-, Lenden- und Kreuzbein, von denen jeder mehrere Segmente enthält. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Gliedmaßen hat der Nervenapparat derjenigen Segmente des Rückenmarks, die sie innervieren, die größte Entwicklung erfahren. Dies spiegelte sich in der Bildung von Verdickungen im Hals- und Lendenbereich wider. Im Bereich der Verdickung des Rückenmarks enthalten die Wurzeln die meisten Fasern und weisen die größte Dicke auf.
Auf einem Querschnitt des Rückenmarks sind die zentral gelegene graue Substanz, die aus einer Ansammlung von Nervenzellen besteht, und die umgebende weiße Substanz, die aus Nervenfasern besteht, deutlich zu erkennen. In der grauen Substanz gibt es Bauch- und Rückenhörner, zwischen denen eine Zwischenzone liegt. Darüber hinaus gibt es in den Brustsegmenten auch seitliche Vorsprünge der grauen Substanz – die seitlichen Hörner.
Alle neuronalen Elemente des Rückenmarks können in 4 Hauptgruppen eingeteilt werden: efferente Neuronen, Interneuronen, Neuronen der aufsteigenden Bahnen und intraspinale Fasern sensorischer afferenter Neuronen. Motoneuronen sind in den Vorderhörnern konzentriert und bilden dort spezifische Kerne, deren Zellen alle ihre Axone an einen bestimmten Muskel senden. Jeder motorische Kern erstreckt sich normalerweise in mehrere Segmente. Daher verlassen die Axone von Motoneuronen, die denselben Muskel innervieren, das Rückenmark als Teil mehrerer ventraler Wurzeln.
Zusätzlich zu den motorischen Kernen in den Vorderhörnern werden in der Zwischenzone der grauen Substanz große Ansammlungen von Nervenzellen unterschieden. Dies ist der Hauptkern der Interneurone des Rückenmarks. Die Axone von Interneuronen erstrecken sich sowohl innerhalb eines Segments als auch in die nächstgelegenen Nachbarsegmente.
Eine charakteristische Ansammlung von Nervenzellen befindet sich auch im dorsalen Teil des Hinterhorns. Diese Zellen bilden dichte Geflechte, und diese Zone wird die gallertartige Substanz von Roland genannt.
Die genaueste und systematischste Vorstellung von der Topographie der Nervenzellen der grauen Substanz des Rückenmarks erhält man durch die Unterteilung in aufeinanderfolgende Schichten oder Platten, in denen jeweils hauptsächlich Neuronen des gleichen Typs gruppiert sind.
Obwohl die geschichtete Typografie der grauen Substanz ursprünglich im Rückenmark der Katze identifiziert wurde, hat sie sich als recht universell erwiesen und ist durchaus auf das Rückenmark anderer Wirbeltiere und des Menschen anwendbar.
Nach diesen Daten kann die gesamte graue Substanz in 10 Platten unterteilt werden. Die allererste Rückenplatte enthält hauptsächlich sogenannte Randneuronen. Ihre Axone ragen nach rostral und bilden den Tractus spinothalamicus. Die Fasern des Lissauer-Trakts, der aus einer Mischung primärer afferenter Fasern und Axonen propriospinaler Neuronen besteht, enden an den Randneuronen.
Die zweite und dritte Platte bilden eine gallertartige Substanz. Hier sind hauptsächlich zwei Arten von Neuronen lokalisiert: kleinere und relativ größere Neuronen. Obwohl die Zellkörper der Neuronen in der zweiten Lamina einen kleinen Durchmesser haben, sind ihre dendritischen Verzweigungen recht zahlreich. Die Axone der Neuronen in der zweiten Platte projizieren zum Lissauer-Trakt und zum dorsolateralen Fasciculus propria des Rückenmarks, viele verbleiben jedoch innerhalb der Substantia gelatinosa. Auf den Zellen der zweiten und dritten Platte enden die Fasern primärer afferenter Neuronen, hauptsächlich Haut- und Schmerzempfindlichkeit.
Die vierte Platte nimmt ungefähr die Mitte des Hinterhorns ein. Die Dendriten der Schicht-IV-Neuronen dringen in die Substantia gelatinosa ein und ihre Axone projizieren zum Thalamus und zum lateralen Zervikalkern. Sie erhalten synaptische Eingaben von Neuronen der Substantia gelatinosa und ihre Axone projizieren zum Thalamus und zum lateralen Halskern. Sie erhalten synaptische Eingaben von Neuronen der Substantia gelatinosa und primären afferenten Neuronen.
Im Allgemeinen nehmen die Nervenzellen der ersten bis vierten Laminae die gesamte Spitze des Hinterhorns ein und bilden den primären Sinnesbereich des Rückenmarks. Hier werden die Fasern der meisten dorsalen Wurzelafferenzen von Exterozeptoren, einschließlich Haut und Schmerzempfindlichkeit, projiziert. In derselben Zone sind Nervenzellen lokalisiert, wodurch mehrere aufsteigende Bahnen entstehen.
Die fünfte und sechste Platte enthalten zahlreiche Arten von Interneuronen, die synaptische Eingaben von dorsalen Wurzelfasern und absteigenden Bahnen erhalten, insbesondere vom kortikospinalen und rubrospinalen Trakt.
Propriospinale Interneurone sind in der siebten und achten Platte lokalisiert und führen zu langen Axonen, die Neuronen in entfernten Segmenten erreichen. Hier enden afferente Fasern von Propriozeptoren, Fasern des Vestibulospinal- und Retikulospinaltrakts sowie Axone propriospinaler Neuronen.
Die neunte Platte enthält die Körper der a- und g-Motoneuronen. Dieser Bereich wird auch von den präsynaptischen Enden primärer afferenter Fasern von Muskeldehnungsrezeptoren, den Enden von Fasern der absteigenden Bahnen, kortikospinalen Fasern und den Axonendigungen erregender und hemmender Interneurone erreicht.
Die zehnte Platte umgibt den Spinalkanal und enthält neben Neuronen eine beträchtliche Anzahl von Gliazellen und Kommissurfasern.
Neurogliazellen des Rückenmarks bedecken zu einem beträchtlichen Teil die Oberfläche von Neuronen, und die Fortsätze der Gliazellen sind einerseits auf die Körper von Neuronen gerichtet und andererseits häufig in Kontakt mit Blutkapillaren und wirken als Vermittler zwischen Nervenelementen und ihren Nahrungsquellen.
Das Rückenmark überträgt Signale über die aufsteigenden Bahnen an die suprasegmentalen Ebenen des Gehirns und erhält von dort über die absteigenden Bahnen Handlungsbefehle. Die aufsteigenden Bahnen übertragen Impulse von Propriozeptoren entlang der Fasern der spinobulbären Faszikel von Gaulle und Burdach und der spinozerebellären Bahnen von Govers und Flexigo, von Schmerz- und Temperaturrezeptoren entlang der lateralen spinothalamischen Bahn, von taktilen Rezeptoren entlang der ventralen spinothalamischen Bahn und teilweise entlang der Faszikel von Gaulle und Burdach.
Die absteigenden Bahnen bestehen aus kortikospinalen oder Pyramidenbahnen und extrakortikospinalen oder extrapyramidalen Bahnen.
Um die Arbeit der inneren Organe, motorischen Funktionen, den rechtzeitigen Empfang und die Übertragung von Sympathikus- und Refleximpulsen zu steuern, werden die Bahnen des Rückenmarks genutzt. Störungen in der Impulsübertragung führen zu gravierenden Störungen der Funktion des gesamten Körpers.
Welche leitende Funktion hat das Rückenmark?
Der Begriff „Leitbahnen“ bezieht sich auf eine Reihe von Nervenfasern, die Signale an verschiedene Zentren der grauen Substanz übertragen. Die aufsteigende und absteigende Bahn des Rückenmarks übernimmt die Hauptfunktion der Impulsübertragung. Es ist üblich, drei Gruppen von Nervenfasern zu unterscheiden:- Assoziative Wege.
- Kommissarische Verbindungen.
- Projektion Nervenfasern.
Sensorische und motorische Bahnen sorgen für eine starke Verbindung zwischen Rückenmark und Gehirn, inneren Organen, Muskulatur und Bewegungsapparat. Dank der schnellen Impulsübertragung werden alle Körperbewegungen koordiniert und ohne spürbare Anstrengung des Menschen ausgeführt.
Woraus besteht das Rückenmark?
Die Hauptbahnen werden durch Zellbündel – Neuronen – gebildet. Diese Struktur sorgt für die nötige Geschwindigkeit der Impulsübertragung.Die Einteilung der Bahnen richtet sich nach den funktionellen Eigenschaften der Nervenfasern:
- Aufsteigende Bahnen des Rückenmarks – Signale lesen und übertragen: von der Haut und den Schleimhäuten eines Menschen, lebenserhaltenden Organen. Stellen Sie die Funktionen des Bewegungsapparates sicher.
- Absteigende Bahnen des Rückenmarks – übertragen Impulse direkt an die Arbeitsorgane des menschlichen Körpers – Muskelgewebe, Drüsen usw. Direkt mit der kortikalen grauen Substanz verbunden. Die Übertragung von Impulsen erfolgt über die neuronale Verbindung der Wirbelsäule zu den inneren Organen.
Das Rückenmark verfügt über zwei Richtungsbahnen, die eine schnelle Impulsübertragung von Informationen von kontrollierten Organen gewährleisten. Die leitende Funktion des Rückenmarks wird durch die wirksame Übertragung von Impulsen durch das Nervengewebe gewährleistet.
In der medizinischen und anatomischen Praxis ist es üblich, folgende Begriffe zu verwenden: 
Wo liegen die Gehirnbahnen im Rücken?
Alle Nervengewebe befinden sich in der grauen und weißen Substanz und verbinden die Hörner der Wirbelsäule mit der Großhirnrinde.Die morphofunktionellen Eigenschaften der absteigenden Bahnen des Rückenmarks begrenzen die Impulsrichtung nur in eine Richtung. Die Reizung der Synapsen erfolgt von der präsynaptischen bis zur postsynaptischen Membran.
Die Leitungsfunktion des Rückenmarks und des Gehirns entspricht den folgenden Fähigkeiten und der Lage der wichtigsten auf- und absteigenden Bahnen:
- Assoziative Bahnen sind „Brücken“, die Bereiche zwischen dem Kortex und den Kernen der grauen Substanz verbinden. Bestehen aus kurzen und langen Fasern. Die ersten befinden sich innerhalb einer Hälfte oder eines Lappens der Großhirnhemisphären.
Lange Fasern sind in der Lage, Signale durch 2-3 Segmente der grauen Substanz zu übertragen. Im Rückenmark bilden Neuronen intersegmentale Bündel. - Kommissuralfasern – bilden den Corpus callosum und verbinden die neu gebildeten Teile des Rückenmarks und des Gehirns. Sie verteilen sich strahlend. Befindet sich in der weißen Substanz des Gehirngewebes.
- Projektionsfasern – die Lage der Bahnen im Rückenmark ermöglicht es den Impulsen, die Großhirnrinde so schnell wie möglich zu erreichen. Je nach Natur und funktionellen Eigenschaften werden Projektionsfasern in aufsteigende (afferente Bahnen) und absteigende Fasern unterteilt.
Die ersten werden in exterozeptive (Sehen, Hören), propriozeptive (motorische Funktionen) und interozeptive (Kommunikation mit inneren Organen) unterteilt. Die Rezeptoren befinden sich zwischen der Wirbelsäule und dem Hypothalamus.

Die Anatomie der Bahnen ist für eine Person, die keine hat, ziemlich komplex medizinische Ausbildung. Aber die neuronale Übertragung von Impulsen macht den menschlichen Körper zu einem Ganzen.
Folgen von Wegeschäden
Um die Neurophysiologie der sensorischen und motorischen Bahnen zu verstehen, ist es hilfreich, ein wenig über die Anatomie der Wirbelsäule zu wissen. Das Rückenmark hat eine Struktur, die einem Zylinder ähnelt, der von Muskelgewebe umgeben ist. Innerhalb der grauen Substanz gibt es Leitungen, die die Funktion der inneren Organe sowie motorische Funktionen steuern. Assoziative Bahnen sind für Schmerz und Tastempfindungen verantwortlich. Motor - für Reflexfunktionen Körper.
Innerhalb der grauen Substanz gibt es Leitungen, die die Funktion der inneren Organe sowie motorische Funktionen steuern. Assoziative Bahnen sind für Schmerz und Tastempfindungen verantwortlich. Motor - für Reflexfunktionen Körper.
Infolge von Verletzungen, Fehlbildungen oder Erkrankungen des Rückenmarks kann die Leitfähigkeit abnehmen oder ganz aufhören. Dies geschieht aufgrund des Absterbens von Nervenfasern. Eine vollständige Störung der Weiterleitung von Rückenmarksimpulsen ist durch Lähmungen und mangelnde Sensibilität der Gliedmaßen gekennzeichnet. Es kommt zu Funktionsstörungen innerer Organe, für die die beschädigte Nervenverbindung verantwortlich ist. So kommt es bei einer Schädigung des unteren Teils des Rückenmarks zu Harninkontinenz und spontanem Stuhlgang.
Die Reflex- und Reizleitungsaktivität des Rückenmarks wird unmittelbar nach Einsetzen degenerativer pathologischer Veränderungen gestört. Nervenfasern sterben ab und sind schwer wiederherzustellen. Die Krankheit schreitet schnell voran und es kommt zu schweren Erregungsleitungsstörungen. Fahren Sie aus diesem Grund mit fort medikamentöse Behandlung so schnell wie möglich notwendig.
So stellen Sie die Durchgängigkeit des Rückenmarks wieder her
Bei der Behandlung der Nichtleitfähigkeit geht es in erster Linie darum, das Absterben von Nervenfasern zu stoppen und die Ursachen zu beseitigen, die zum Auslöser pathologischer Veränderungen wurden.Medikamentöse Behandlung
Es besteht darin, Medikamente zu verschreiben, die das Absterben von Gehirnzellen verhindern und eine ausreichende Blutversorgung des geschädigten Bereichs des Rückenmarks gewährleisten. Dies berücksichtigt Altersmerkmale Leitungsfunktion des Rückenmarks und die Schwere der Verletzung oder Erkrankung.Um die Nervenzellen weiter zu stimulieren, wird die Behandlung mit elektrischen Impulsen eingesetzt, um den Muskeltonus aufrechtzuerhalten.
Operation
Eine Operation zur Wiederherstellung der Leitfähigkeit des Rückenmarks betrifft zwei Hauptbereiche:- Eliminierung von Katalysatoren, die eine Lähmung neuronaler Verbindungen verursachen.
- Stimulation des Rückenmarks zur Wiederherstellung verlorener Funktionen.
Traditionelle Medizin bei Erregungsleitungsstörungen
Volksheilmittel gegen Reizleitungsstörungen des Rückenmarks sollten, sofern sie eingesetzt werden, mit äußerster Vorsicht angewendet werden, um den Zustand des Patienten nicht zu verschlechtern.Besonders beliebt sind: 
Es ist ziemlich schwierig, neuronale Verbindungen nach einer Verletzung vollständig wiederherzustellen. Viel hängt von der schnellen Kontaktaufnahme ab Ärztezentrum und qualifizierte Unterstützung durch einen Neurochirurgen. Je mehr Zeit seit Beginn degenerativer Veränderungen vergeht, desto geringer ist die Chance, die Funktionsfähigkeit des Rückenmarks wiederherzustellen.
Morphofunktionelle Organisation des Rückenmarks
Das Rückenmark ist der älteste Teil des zentralen Nervensystems der Wirbeltiere. Die Lanzette, der primitivste Vertreter der Akkordaten, hat es bereits.
Das Rückenmark ist der kaudale Teil des Zentralnervensystems. Es befindet sich im Wirbelkanal und ist bei verschiedenen Vertretern der Wirbeltiere unterschiedlich lang.
Beim Menschen sind im kaudalen Teil des Wirbelkanals die Wurzeln der kaudalen Teile des Rückenmarks gesammelt und bilden die sogenannte Cauda equina.
Rückenmark gekennzeichnet durch eine segmentale Struktur. Das Rückenmark ist in Hals-, Brust-, Lenden-, Kreuzbein- und Steißbeinabschnitte unterteilt. Jede Abteilung besteht aus mehreren Segmenten. Die Halsregion umfasst 8 Segmente (C 1 – C 8), die Brustregion – 12 (Th 1 – Th 12), die Lendenwirbelsäule – 5 (L 1 – L 5), die Kreuzbeinregion – 5 (S 1 – S 5) und die Steißbeinregion – 1 - 3 (Co 1 – Co 3). Von jedem Segment gehen zwei Wurzelpaare aus, die einem der Wirbel entsprechen und den Wirbelkanal durch das Loch zwischen ihnen verlassen.
Es gibt dorsale (hintere) und ventrale (vordere) Wurzeln. Die Rückenwurzeln werden von den zentralen Axonen primärer afferenter Neuronen gebildet, deren Körper in den Rückenganglien liegen.
Die ventralen Wurzeln werden von Axonen von α- und γ-Motoneuronen und nichtmyelinisierten Fasern von Neuronen des autonomen Nervensystems gebildet. Diese Verteilung afferenter und efferenter Fasern wurde unabhängig voneinander festgestellt Anfang des 19. Jahrhunderts Jahrhundert von C. Bell (1811) und F. Magendie (1822). Die unterschiedliche Funktionsverteilung in den vorderen und hinteren Wurzeln des Rückenmarks wird als Bell-Magendie-Gesetz bezeichnet. Die Rückenmarkssegmente und Wirbel entsprechen einem Metamer. Die Nervenfasern eines Rückenwurzelpaares verlaufen nicht nur zu ihrem eigenen Metamer, sondern auch darüber und darunter – zu benachbarten Metameren. Der Hautbereich, in dem diese Sinnesfasern verteilt sind, wird Dermatom genannt.
Die Anzahl der Fasern in der dorsalen Wurzel ist viel größer als in der ventralen.
Neuronale Strukturen des Rückenmarks. Der zentrale Teil des Rückenmarksquerschnitts wird von grauer Substanz eingenommen. Die graue Substanz ist von weißer Substanz umgeben. In der grauen Substanz gibt es Vorder-, Hinter- und Seitenhörner und in der weißen Substanz Säulen (ventral, dorsal, lateral usw.).
Die neuronale Zusammensetzung des Rückenmarks ist sehr vielfältig. Es gibt verschiedene Arten von Neuronen. Die Zellkörper der dorsalen Ganglienneuronen liegen außerhalb des Rückenmarks. Das Rückenmark enthält die Axone dieser Neuronen. Neuronen der Spinalganglien sind unipolare oder pseudounipolare Neuronen. Die Rückenganglien enthalten die Körper somatischer Afferenzen, die hauptsächlich die Skelettmuskulatur innervieren. Die Körper anderer sensorischer Neuronen befinden sich im Gewebe und in den intramuralen Ganglien des autonomen Nervensystems und sorgen nur für die Empfindlichkeit der inneren Organe. Es gibt sie in zwei Ausführungen: groß – mit einem Durchmesser von 60–120 Mikrometern und klein – mit einem Durchmesser von 14–30 Mikrometern. Große produzieren myelinisierte Fasern und kleine produzieren myelinisierte und nichtmyelinisierte Fasern. Nervenfasern von Sinneszellen werden nach Leitungsgeschwindigkeit und Durchmesser in A-, B- und C-Fasern eingeteilt. Dicke myelinisierte A-Fasern Mit einem Durchmesser von 3 bis 22 Mikrometern und einer Leitungsgeschwindigkeit von 12 bis 120 m/s werden sie in Untergruppen eingeteilt: Alphafasern – von Muskelrezeptoren, Betafasern – von Tast- und Barorezeptoren, Deltafasern – von Thermorezeptoren, Mechanorezeptoren und Schmerz Rezeptoren. ZU Fasern der Gruppe B umfassen myelinisierte Fasern mittlerer Dicke mit einer Erregungsgeschwindigkeit von 3-14 m/s. Sie übertragen hauptsächlich das Schmerzempfinden. ZU Afferenzen vom Typ C umfassen den Großteil der nicht myelinisierten Fasern mit einer Dicke von nicht mehr als 2 Mikrometern und einer Leitungsgeschwindigkeit von bis zu 2 m/s. Dabei handelt es sich um Fasern, die von Schmerz-, Chemo- und einigen Mechanorezeptoren stammen.
Die graue Substanz des Rückenmarks enthält die folgenden Elemente:
1) efferente Neuronen (Motoneuronen);
2) Interneurone;
3) Neuronen der aufsteigenden Bahnen;
4) intraspinale Fasern empfindlicher afferenter Neuronen.
Motorische Neuronen konzentriert sich in den Vorderhörnern, wo sie spezifische Kerne bilden, deren Zellen alle ihre Axone zu einem bestimmten Muskel senden. Jeder motorische Kern erstreckt sich normalerweise über mehrere Segmente, daher verlassen ihre Axone, die denselben Muskel innervieren, das Rückenmark als Teil mehrerer ventraler Wurzeln.
Interneurone sind in der Zwischenzone der grauen Substanz lokalisiert. Ihre Axone erstrecken sich sowohl innerhalb des Segments als auch in die nächsten Nachbarsegmente. Interneurone- eine heterogene Gruppe, deren Dendriten und Axone das Rückenmark nicht verlassen. Interneurone gehen synaptische Kontakte nur mit anderen Neuronen ein, und zwar in der Mehrzahl. Interneurone machen etwa 97 % aller Neuronen aus. Sie sind kleiner als α-Motoneuronen und können hochfrequente Impulse (über 1000 pro Sekunde) auslösen. Für propriospinale Interneurone gekennzeichnet durch die Eigenschaft, lange Axone durch mehrere Segmente zu schicken und auf Motoneuronen zu enden. Gleichzeitig laufen auf diesen Zellen Fasern verschiedener absteigender Bahnen zusammen. Daher sind sie Relaisstationen auf dem Weg von darüber liegenden Neuronen zu Motoneuronen. Eine besondere Gruppe von Interneuronen bilden inhibitorische Neuronen. Hierzu zählen beispielsweise Renshaw-Zellen.
Neuronen der aufsteigenden Bahnen liegen ebenfalls vollständig im Zentralnervensystem. Die Zellkörper dieser Neuronen befinden sich in der grauen Substanz des Rückenmarks.
Zentrale Enden primärer Afferenzen haben ihre eigenen Eigenschaften. Nach Eintritt in das Rückenmark entstehen aus der afferenten Faser meist aufsteigende und absteigende Äste, die beträchtliche Distanzen entlang des Rückenmarks zurücklegen können. Die Endäste einer afferenten Nervenfaser haben zahlreiche Synapsen an einem Motoneuron. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass eine vom Dehnungsrezeptor ausgehende Faser Synapsen mit fast allen Motoneuronen eines bestimmten Muskels bildet.
Im dorsalen Teil des Hinterhorns befindet sich die gallertartige Substanz von Roland.
Die genaueste Vorstellung von der Topographie der Nervenzellen der grauen Substanz des Rückenmarks erhält man durch die Unterteilung in aufeinanderfolgende Schichten oder Platten, in denen in der Regel jeweils Neuronen des gleichen Typs gruppiert sind.
Nach diesen Daten wurde die gesamte graue Substanz des Rückenmarks in 10 Platten (Rexed) unterteilt (Abb. 2.2).
I – Randneuronen – bilden den Spinothalamustrakt;
II-III – gallertartige Substanz;
I-IV – im Allgemeinen der primäre sensorische Bereich des Rückenmarks (Afferentation von Exterozeptoren, Afferenzierung von Haut- und Schmerzrezeptoren);
Reis. 2.2. Aufteilung der grauen Substanz des Rückenmarks in Platten (nach Reksed)
V-VI – Interneurone sind lokalisiert, die Eingaben von den Rückenwurzeln und den absteigenden Bahnen (kortikospinal, rubrospinal) erhalten;
VII-VIII – Propriospinale Interneurone werden lokalisiert (von Propriozeptoren, vestibulospinalen und retikulospinalen Fasern)
naltrakt), Axone propriospinaler Neuronen;
IX – enthält die Körper von α- und γ-Motoneuronen, präsynaptische Fasern primärer Afferenzen von Muskeldehnungsrezeptoren, die Enden von Fasern der absteigenden Bahnen;
X – umgibt den Wirbelkanal und enthält neben Neuronen eine erhebliche Anzahl von Gliazellen und Kommissurfasern.
Eigenschaften der Nervenelemente des Rückenmarks. Das menschliche Rückenmark enthält etwa 13 Millionen Neuronen.
α-Motoneuronen sind große Zellen mit langen Dendriten und bis zu 20.000 Synapsen, von denen die meisten durch die Enden intraspinaler Interneurone gebildet werden. Die Leitungsgeschwindigkeit entlang ihres Axons beträgt 70–120 m/s. Charakteristisch sind rhythmische Entladungen mit einer Frequenz von maximal 10-20 Impulsen/s, die mit einer ausgeprägten Spurenhyperpolarisation einhergehen. Dies sind die Ausgabeneuronen. Sie übertragen Signale an die im Rückenmark produzierten Skelettmuskelfasern.
γ-Motoneuronen sind kleinere Zellen. Ihr Durchmesser beträgt nicht mehr als 30-40 Mikrometer, sie haben keinen direkten Kontakt mit primären Afferenzen.
γ-Motoneuronen innervieren intrafusale (intraspindelige) Muskelfasern.
Sie werden monosynaptisch durch Fasern der absteigenden Bahnen aktiviert, was eine wichtige Rolle bei der α-, γ-Wechselwirkung spielt. Die Leitungsgeschwindigkeit entlang ihres Axons ist geringer – 10–40 m/s. Die Pulsfrequenz ist höher als die des α-Motors.
Neuronen, – 300-500 Impulse/s.
In den Seiten- und Vorderhörnern befinden sich präganglionäre Neuronen des autonomen Nervensystems – ihre Axone sind auf die Ganglienzellen der sympathischen Nervenkette und auf die intramuralen Ganglien innerer Organe gerichtet.
Die Körper sympathischer Neuronen, deren Axone präganglionäre Fasern bilden, befinden sich im intermediolateralen Kern des Rückenmarks. Ihre Axone gehören zur Gruppe der B-Fasern. Sie zeichnen sich durch ständige tonische Impulse aus. Einige dieser Fasern sind an der Aufrechterhaltung des Gefäßtonus beteiligt, während andere an der Regulierung viszeraler Effektorstrukturen (glatte Muskeln des Verdauungssystems, Drüsenzellen) beteiligt sind.
Die Körper parasympathischer Neuronen bilden die sakralen parasympathischen Kerne. Sie befinden sich in der grauen Substanz des sakralen Rückenmarks. Viele von ihnen zeichnen sich durch eine Hintergrundimpulsaktivität aus, deren Häufigkeit beispielsweise mit zunehmendem Druck in der Blase zunimmt.
Das Rückenmark besteht aus zwei symmetrischen Hälften, die vorne durch die tiefe Medianfissur und hinten durch den Sulcus medianus voneinander abgegrenzt sind. Das Rückenmark zeichnet sich durch eine segmentale Struktur aus; Jedes Segment ist mit einem Paar vorderer (ventraler) und einem Paar hinterer (dorsaler) Wurzeln verbunden.
Das Rückenmark ist in graue Substanz im zentralen Teil und weiße Substanz am Rand unterteilt.
Die weiße Substanz des Rückenmarks ist eine Ansammlung in Längsrichtung ausgerichteter, überwiegend myelinisierter Nervenfasern. Die Nervenfaserbündel, die zwischen verschiedenen Teilen des Nervensystems kommunizieren, werden als Bahnen oder Bahnen des Rückenmarks bezeichnet.
Die graue Substanz hat im Querschnitt die Form eines Schmetterlings und umfasst die vorderen oder ventralen, hinteren oder dorsalen und seitlichen oder seitlichen Hörner. Die graue Substanz enthält die Körper, Dendriten und (teilweise) Axone von Neuronen sowie Gliazellen. Basic Bestandteil graue Substanz sind multipolare Neuronen.
Zellen ähnlicher Größe, Feinstruktur und funktioneller Bedeutung liegen in der grauen Substanz in Gruppen, die Kerne genannt werden.
Die Axone der Wurzelzellen verlassen das Rückenmark als Teil seiner Vorderwurzeln. Die Prozesse der inneren Zellen enden an Synapsen in der grauen Substanz des Rückenmarks. Die Axone der Büschelzellen durchdringen die weiße Substanz in separaten Faserbündeln, die Nervenimpulse von bestimmten Kernen des Rückenmarks zu seinen anderen Segmenten oder zu den entsprechenden Teilen des Gehirns transportieren und so Bahnen bilden. Einzelne Bereiche der grauen Substanz des Rückenmarks unterscheiden sich deutlich voneinander in der Zusammensetzung von Neuronen, Nervenfasern und Neuroglia.
Die Rückenhörner sind in die schwammige Schicht, die gallertartige Substanz, den Kern des eigentlichen Rückenhorns und den Brustkern von Clarke unterteilt. Zwischen Hinter- und Seitenhorn ragt die graue Substanz strangförmig in die weiße Substanz hinein, wodurch sich deren netzartige Auflockerung, die sogenannte Formatio reticularis oder Formatio reticularis, des Rückenmarks bildet.
Die Hinterhörner sind reich an diffus verteilten Interkalarzellen. Hierbei handelt es sich um kleine multipolare Assoziations- und Kommissurzellen, deren Axone innerhalb der grauen Substanz des Rückenmarks der gleichen Seite (Assoziationszellen) oder der gegenüberliegenden Seite (Kommissuralzellen) enden.
Neuronen der schwammigen Zone und der gallertartigen Substanz kommunizieren zwischen den Sinneszellen der Spinalganglien und den motorischen Zellen der Vorderhörner und schließen lokale Reflexbögen.
Clark-Neuronen empfangen Informationen von Muskel-, Sehnen- und Gelenkrezeptoren (propriozeptive Sensibilität) entlang der dicksten Wurzelfasern und leiten sie an das Kleinhirn weiter.
In der Zwischenzone befinden sich Zentren des autonomen (autonomen) Nervensystems – präganglionäre cholinerge Neuronen seiner sympathischen und parasympathischen Abteilungen.
Die Vorderhörner enthalten die größten Neuronen des Rückenmarks, die große Kerne bilden. Dies ist dasselbe wie bei den Neuronen der Kerne der Seitenhörner, den Wurzelzellen, da ihre Neuriten den Großteil der Fasern der Vorderwurzeln ausmachen. Als Teil der gemischten Spinalnerven dringen sie in die Peripherie ein und bilden motorische Endungen in der Skelettmuskulatur. Somit stellen die Kerne der Vorderhörner motorische somatische Zentren dar.
Das Nervensystem ist üblicherweise in mehrere Abschnitte unterteilt. Nach topografischen Merkmalen wird es in zentrale und periphere Abschnitte und nach funktionellen Merkmalen in somatische und vegetative Abschnitte unterteilt. Der zentrale Bereich oder das Zentralnervensystem umfasst das Gehirn und das Rückenmark. Der periphere Abschnitt bzw. das periphere Nervensystem umfasst alle Nerven, also alle peripheren Bahnen, die aus sensorischen und motorischen Nervenfasern bestehen. Die somatische Abteilung oder das somatische Nervensystem umfasst Hirn- und Spinalnerven, die das Zentralnervensystem mit Organen verbinden, die äußere Reize wahrnehmen – mit der Haut und dem Bewegungsapparat. Die autonome Abteilung oder das autonome Nervensystem sorgt für die Kommunikation zwischen dem Zentralnervensystem und allen inneren Organen, Drüsen, Gefäßen und Organen, die glattes Muskelgewebe enthalten. Der autonome Teil wird in den sympathischen und den parasympathischen Teil bzw. das sympathische und parasympathische Nervensystem unterteilt.
Das zentrale Nervensystem umfasst das Gehirn und das Rückenmark. Es gibt bestimmte Zusammenhänge zwischen der Masse des Gehirns und des Rückenmarks: Mit zunehmender Organisation des Tieres nimmt sie zu relative Masse Gehirn im Vergleich zum Rückenmark. Bei Vögeln ist das Gehirn 1,5-2,5-mal größer als das Rückenmark, bei Huftieren 2,5-3-mal, bei Fleischfressern 3,5-5-mal und bei Primaten 8-15-mal.
Rückenmark- Medulla spinalis liegt im Spinalkanal und nimmt etwa 2/3 seines Volumens ein. Bei Rindern und Pferden beträgt seine Länge 1,8–2,3 m, sein Gewicht 250–300 g, bei Schweinen 45–70 g. Es sieht aus wie eine zylindrische Schnur, die dorsoventral etwas abgeflacht ist. Es gibt keine klare Grenze zwischen Gehirn und Rückenmark. Es wird angenommen, dass es auf Höhe der kranialen Atlaskante verläuft. Das Rückenmark wird entsprechend seiner Lage in zervikale, thorakale, lumbale, sakrale und kaudale Teile unterteilt. IN Embryonalperiode Während der Entwicklung füllt das Rückenmark den gesamten Wirbelkanal aus, aufgrund des hohen Skelettwachstums wird der Längenunterschied jedoch größer. Dadurch endet das Gehirn beim Rind auf Höhe des 4. Lendenwirbels, beim Schwein – im Bereich des 6. Lendenwirbels und beim Pferd – im Bereich des 1. Segments des Kreuzbeins. Die mittlere Rückenfurche (Furche) verläuft entlang der Rückenseite des Rückenmarks. Das bindegewebige dorsale Septum erstreckt sich tiefer davon. An den Seiten oder dem Sulcus medianus befinden sich kleinere dorsale Seitenfurchen. Entlang der ventralen Seite befindet sich ein tiefer medianer ventraler Spalt und an den Seiten davon ventrale seitliche Rillen (Rillen). Am Ende verengt sich das Rückenmark stark und bildet einen Markkegel, der in das Filum terminale übergeht. Es besteht aus Bindegewebe und endet auf Höhe des ersten Schwanzwirbels.
Im zervikalen und lumbalen Teil des Rückenmarks kommt es zu Verdickungen. Durch die Entwicklung der Gliedmaßen nimmt in diesen Bereichen die Anzahl der Neuronen und Nervenfasern zu. Beim Schwein wird die Zervixverdickung durch das 5.–8. Neurosegment gebildet. Seine maximale Breite in Höhe der Mitte des 6. Halswirbels beträgt 10 mm. Eine lumbale Verdickung tritt im 5.–7. lumbalen Neurosegment auf. In jedem Segment verlässt ein Spinalnervenpaar das Rückenmark in zwei Wurzeln – rechts und links. Die dorsale Wurzel entspringt dem Sulcus dorsalis lateralis, die ventrale Wurzel dem Sulcus ventral laterales. Die Spinalnerven verlassen den Spinalkanal durch die Foramina intervertebralis. Der Abschnitt des Rückenmarks zwischen zwei benachbarten Spinalnerven wird als Neurosegment bezeichnet. Neurosegmente kommen in unterschiedlichen Längen vor und entsprechen in ihrer Größe oft nicht der Länge des Knochensegments. Dadurch treten die Spinalnerven in unterschiedlichen Winkeln aus. Viele von ihnen wandern über eine gewisse Distanz durch den Wirbelkanal, bevor sie das Foramen intervertebrale ihres Segments verlassen. In kaudaler Richtung vergrößert sich dieser Abstand und aus den im Wirbelkanal verlaufenden Nerven hinter dem Conus medullaris bildet sich ein Pinsel, der „Pferdeschwanz“ genannt wird.
Gehirn- Enzephalon - befindet sich in der Schädelbox und besteht aus mehreren Teilen. Bei Huftieren beträgt die relative Masse des Gehirns 0,08–0,3 % des Körpergewichts, was bei einem Pferd 370–600 g, bei Rindern 220–450 g und bei Schafen und Schweinen 96–150 g entspricht Die Masse des Gehirns ist normalerweise größer als die großer.
Das Gehirn von Huftieren ist halboval. Bei Wiederkäuern haben sie eine breite Frontalebene, fast keine hervorstehenden Riechkolben und deutliche Erweiterungen auf der Ebene der Schläfenregionen. Beim Schwein ist es vorne schmaler, mit deutlich hervorstehenden Riechkolben. Seine Länge beträgt durchschnittlich 15 cm bei Rindern, 10 cm bei Schafen, 11 cm bei Schweinen. Das Gehirn ist unterteilt in großes Gehirn rostral liegend und das Rautenhirn kaudal gelegen. Phylogenetisch ältere Bereiche des Gehirns, die eine Fortsetzung der Projektionsbahnen des Rückenmarks darstellen, werden als Hirnstamm bezeichnet. Es umfasst die Medulla oblongata, die Markbrücke, die Mittelbrücke und einen Teil des Zwischenhirns. Phylogenetisch jüngere Teile des Gehirns bilden den integumentären Teil des Gehirns. Es umfasst die Großhirnhemisphären und das Kleinhirn.
Diamantgehirn- Rhombencephalon - ist in Medulla oblongata und Hinterhirn unterteilt und enthält den vierten Großhirnventrikel.
Mark- Medulla oblongata – der hinterste Teil des Gehirns. Seine Masse macht 10-11 % der Gehirnmasse aus; Länge bei Rindern - 4,5, bei Schafen - 3,7, bei Schweinen - 2 cm. Es hat die Form eines abgeflachten Kegels, dessen Basis nach vorne gerichtet ist und an die Markbrücke angrenzt, und der Spitze an das Rückenmark, in das es übergeht ohne scharfe Grenzen.
Auf seiner Rückseite befindet sich eine rautenförmige Vertiefung – der vierte Hirnventrikel. Entlang der Bauchseite befinden sich drei Furchen: eine mittlere und zwei seitliche. Sie verbinden sich kaudal und gelangen in die ventrale Medianfissur des Rückenmarks. Zwischen den Rillen befinden sich zwei schmale längliche Grate – Pyramiden, in denen Bündel motorischer Nervenfasern verlaufen. An der Grenze der Medulla oblongata und des Rückenmarks kreuzen sich die Pyramidenbahnen – es entsteht eine Pyramidenkreuzung. In der Medulla oblongata befindet sich die graue Substanz im Inneren, am Boden des vierten Hirnventrikels, in Form von Kernen, aus denen Hirnnerven entstehen (von den Paaren VI bis XII), sowie von Kernen, in denen Impulse umgeschaltet werden andere Teile des Gehirns. Die weiße Substanz liegt außen, hauptsächlich ventral, und bildet Bahnen. Motorische (efferente) Bahnen vom Gehirn zum Rückenmark bilden Pyramiden. Empfindliche Bahnen (afferent) vom Rückenmark zum Gehirn bilden die hinteren Kleinhirnstiele, die von der Medulla oblongata zum Kleinhirn verlaufen. In der Masse der Medulla oblongata liegt in Form eines Plexus reticus ein wichtiger Koordinationsapparat des Gehirns – die Formatio reticularis. Es verbindet Hirnstammstrukturen und fördert deren Beteiligung an komplexen, mehrstufigen Reaktionen.
Mark- ein lebenswichtiger Teil des Zentralnervensystems (ZNS), dessen Zerstörung zum sofortigen Tod führt. Hier befinden sich die Zentren für Atmung, Herzschlag, Kauen, Schlucken, Saugen, Erbrechen, Kaugummi, Speichelfluss und Saftsekretion, Gefäßtonus usw.
Hinterhirn- Metencephalon - besteht aus dem Kleinhirn und den Markbrücken.
Gehirnbrücke- Pons – eine massive Verdickung auf der ventralen Oberfläche des Gehirns, die sich über den vorderen Teil der Medulla oblongata erstreckt und bei Rindern bis zu 3,5 cm, bei Schafen 2,5 cm und bei Schweinen 1,8 Ohm breit ist. Der Großteil der Gehirnbrücke besteht aus Bahnen (absteigend und aufsteigend), die das Gehirn mit dem Rückenmark und einzelne Teile des Gehirns miteinander verbinden. Große Menge Die Nervenfasern verlaufen über die Brücke zum Kleinhirn und bilden den mittleren Kleinhirnstiel. Die Brücke enthält Gruppen von Kernen, darunter die Kerne der Hirnnerven (V-Paar). Das größte V-Paar der Hirnnerven, die Trigeminusnerven, gehen von der Seitenfläche der Brücke ab.
Kleinhirn- Kleinhirn – befindet sich oberhalb der Pons, der Medulla oblongata und des vierten Großhirnventrikels, hinter dem Quadrigeminus. Vorne grenzt es an die Großhirnhemisphären. Seine Masse macht 10-11 % der Gehirnmasse aus. Bei Schafen und Schweinen ist seine Länge (4–4,5 cm) größer als seine Höhe (2,2–2,7 Ohm), bei Rindern nähert er sich der Kugelform – 5,6 x 6,4 cm. Im Kleinhirn wird der mittlere Teil unterschieden – der Wurm und Seitenteile - Kleinhirnhemisphären. Das Kleinhirn hat 3 Stielpaare. Es ist über die Hinterbeine (Seilkörper) mit der Medulla oblongata, die Mittelbeine mit der Markbrücke und die Vorderbeine (rostral) mit dem Mittelhirn verbunden. Die Oberfläche des Kleinhirns besteht aus zahlreichen gefalteten Läppchen und Windungen, die durch Rillen und Spalten getrennt sind. Die graue Substanz im Kleinhirn befindet sich oberhalb der Kleinhirnrinde und in der Tiefe in Form von Kernen. Die Oberfläche der Kleinhirnrinde beim Rind beträgt 130 cm2 (ca. 30 % im Verhältnis zur Großhirnrinde). Gehirnhälften) mit einer Dicke von 450-700 Mikrometern. Die weiße Substanz befindet sich unter der Rinde und sieht aus wie ein Ast, weshalb sie auch Baum des Lebens genannt wird.
Das Kleinhirn ist das Zentrum für die Koordination willkürlicher Bewegungen sowie für die Aufrechterhaltung des Muskeltonus, der Körperhaltung und des Gleichgewichts.
Diamantgehirn enthält den vierten Hirnventrikel. Sein Boden ist die Vertiefung der Medulla oblongata – die Rautengrube. Seine Wände werden von den Kleinhirnstielen gebildet und das Dach von den vorderen (rostralen) und hinteren Marksegeln, den Plexus choroideus. Der Ventrikel kommuniziert rostral mit dem Aquädukt des Gehirns, kaudal mit dem Zentralkanal des Rückenmarks und durch Öffnungen im Velum mit dem Subarachnoidalraum.
Großes Gehirn- Großhirn – umfasst Telencephalon, Zwischenhirn und Mittelhirn. Telencephalon und Zwischenhirn sind im Vorderhirn zusammengefasst.
Das Mittelhirn – Mesencephalon – besteht aus dem Quadrigeminusstiel, den Großhirnstielen und dem dazwischen eingeschlossenen Großhirn-Aquädukt. Von großen Halbkugeln bedeckt. Seine Masse macht 5-6 % der Gehirnmasse aus.
Das Quadrigeminum bildet das Dach des Mittelhirns. Es besteht aus einem Paar rostraler (vorderer) Colliculi und einem Paar kaudaler (hinterer) Colliculi. Die Quadrigeminusregion ist das Zentrum unbedingter reflexmotorischer Handlungen als Reaktion auf visuelle und auditive Reize. Die vorderen Colliculi gelten als subkortikale Zentren des visuellen Analysators, die hinteren Colliculi gelten als subkortikale Zentren des auditorischen Analysators. Bei Wiederkäuern sind die vorderen Colliculi größer als die hinteren, bei Schweinen ist das Gegenteil der Fall.
Die Stiele des Großhirns bilden den Boden des Mittelhirns. Sie sehen aus wie zwei dicke Grate, die zwischen den Sehbahnen und den Markbrücken liegen. Getrennt durch eine interpedunkuläre Furche.
Zwischen dem Quadrigeminusstiel und den Hirnstielen verläuft der Aquädukt des Gehirns (Sylvian) in Form einer schmalen Röhre. Rostral verbindet er sich mit dem dritten, kaudal mit dem vierten Hirnventrikel. Der Aquädukt des Gehirns ist von der Substanz der Formatio reticularis umgeben.
Im Mittelhirn liegt die weiße Substanz außen und stellt die afferenten und efferenten Bahnen dar. Graue Substanz befindet sich in Form von Kernen in der Tiefe. Das dritte Hirnnervenpaar geht von den Hirnstielen aus.
Zwischenhirn- Zwischenhirn - besteht aus den Sehhügeln - dem Thalamus, dem Epithalamus - dem Epithalamus, dem Hypothalamus - dem Hypothalamus. Zwischen dem Telencephalon liegt das Zwischenhirn.
Im Mittelhirn, bedeckt vom Telencephalon. Seine Masse macht 8-9 % der Gehirnmasse aus. Der visuelle Thalamus ist der massivste und zentral gelegene Teil des Zwischenhirns. Durch ihre Verschmelzung komprimieren sie den dritten Hirnventrikel, so dass er die Form eines Rings annimmt, der um die Zwischenmasse des visuellen Thalamus verläuft. Die Oberseite des Ventrikels ist mit einer Gefäßkappe bedeckt; Das Foramen interventriculare kommuniziert mit den Seitenventrikeln und geht aboral in den Aquädukt des Gehirns über. Oben liegt die weiße Substanz im Thalamus, innen die graue Substanz in Form zahlreicher Kerne. Sie dienen als Schaltglieder von den darunter liegenden Abschnitten zum Kortex und sind mit fast allen Analysatoren verbunden. Auf der Basalfläche des Zwischenhirns befindet sich ein Chiasma der Sehnerven.
Der Epithalamus besteht aus mehreren Strukturen, darunter der Epiphyse und dem vaskulären Tegmentum des dritten Hirnventrikels (die Epiphyse ist eine endokrine Drüse). Befindet sich in der Aussparung zwischen den Tuberculum visualis und dem Quadrigeminum.
Der Hypothalamus befindet sich auf der Basalfläche des Zwischenhirns zwischen dem Chiasma und den Hirnstielen. Besteht aus mehreren Teilen. Direkt hinter dem Chiasma befindet sich in Form eines ovalen Tuberkels ein grauer Tuberkel. Seine nach unten gerichtete Spitze ist durch den Vorsprung der Wand des dritten Ventrikels verlängert und bildet einen Trichter, an dem die Hypophyse, eine endokrine Drüse, aufgehängt ist. Hinter dem grauen Tuberkel befindet sich eine kleine runde Formation – der Mastoidkörper. Die weiße Substanz im Hypothalamus befindet sich außerhalb und bildet afferente und efferente Bahnen. Graue Substanz – in Form zahlreicher Kerne, da der Hypothalamus das höchste subkortikale vegetative Zentrum ist. Es enthält die Zentren für Atmung, Blut- und Lymphzirkulation, Temperatur, sexuelle Funktionen usw.
Das Telencephalon besteht aus zwei Hemisphären, die durch einen tiefen Längsspalt getrennt und durch den Corpus callosum verbunden sind. Seine Masse beträgt bei Rindern 250–300 g, bei Schafen und Schweinen 60–80 g, was 62–66 % der Gehirnmasse entspricht. In jeder Hemisphäre befindet sich dorsolateral ein Mantel, ventromedial – das Riechhirn, in der Tiefe – Striatum und lateraler Ventrikel. Die Ventrikel sind durch ein transparentes Septum getrennt. Sie kommunizieren mit dem dritten Hirnventrikel über das Foramen interventriculare.
Das Riechhirn besteht aus mehreren Teilen, die auf der ventralen Oberfläche des Telencephalons sichtbar sind. Rostral, leicht über das Kap hinausragend, befinden sich 2 Riechkolben. Sie besetzen die Fossa des Siebbeins. Durch ein Loch in der Lochplatte des Knochens dringen die Riechfäden in sie ein, die zusammen den Riechnerv bilden. Die Glühbirnen sind die primären Geruchszentren. Von ihnen gehen Riechbahnen ab – afferente Bahnen. Der seitliche Riechtrakt erreicht die birnenförmigen Lappen, die sich seitlich der Hirnstiele befinden. Die medialen Riechbahnen erreichen die mediale Oberfläche des Mantels. Zwischen den Bahnen liegen die Riechdreiecke. Die Birnenlappen und Riechdreiecke sind sekundäre Riechzentren. In den Tiefen des Riechhirns, am Boden der Seitenventrikel, befinden sich die restlichen Teile des Riechhirns. Sie verbinden das Riechhirn mit anderen Teilen des Gehirns. Das Striatum liegt tief in den Hemisphären und stellt einen basalen Komplex von Kernen dar, die subkortikale motorische Zentren sind.
Der Mantel erreicht seine größte Entwicklung bei höheren Säugetieren. Es enthält die höchsten Zentren aller Lebensaktivitäten des Tieres. Die Oberfläche des Mantels ist mit Windungen und Furchen bedeckt. Bei Rindern beträgt seine Oberfläche 600 cm 2. Oben befindet sich die graue Substanz im Mantel – das ist die Großhirnrinde. Im Inneren befindet sich die weiße Substanz – das sind die Bahnen. Die Funktionen verschiedener Teile des Kortex sind ungleich, die Struktur ist mosaikartig, was die Unterscheidung mehrerer Lappen (Frontal-, Parietal-, Temporal-, Okzipitallappen) und mehrerer Dutzend Felder in den Hemisphären ermöglichte. Die Felder unterscheiden sich voneinander in ihrer Zytoarchitektur – der Lage, Anzahl und Form der Zellen – und ihrer Myeloarchitektur – der Lage, Anzahl und Form der Fasern.
Hirnhäute. Das Rückenmark und das Gehirn sind von harten, spinnenförmigen und weichen Membranen bedeckt.
Die harte Schale ist die oberflächlichste, dickste, besteht aus dichtem Bindegewebe und ist arm an Blutgefäßen. Es verschmilzt mit den Knochen des Schädels und der Wirbel mit Bändern, Falten und anderen Formationen. Es steigt in Form des Ligamentum falciforme (Falx cerebellum) in den Längsspalt zwischen den Großhirnhemisphären ab und trennt das Großhirn vom Rhomboid durch das häutige Tentorium des Kleinhirns. Zwischen ihm und den Knochen befindet sich ein unvollständig entwickelter Epiduralraum, der mit lockerem Binde- und Fettgewebe gefüllt ist. Hier verlaufen die Adern. Die Innenseite der Dura mater ist mit Endothel ausgekleidet. Zwischen ihm und der Arachnoidea befindet sich ein mit Liquor gefüllter Subduralraum. Die Arachnoidea besteht aus lockerem Bindegewebe, ist empfindlich, gefäßlos und reicht nicht bis in die Furchen. Es ist auf beiden Seiten von Endothel bedeckt und durch den Subdural- und Subarachnoidalraum (Subarachnoidalraum) von anderen Membranen getrennt. Es ist mit Hilfe von Bändern sowie durch ihn verlaufenden Gefäßen und Nerven an den Membranen befestigt.
Die Weichschale ist dünn, aber dicht, mit einer großen Anzahl von Gefäßen, weshalb sie auch als Gefäß bezeichnet wird. Es dringt in alle Furchen und Spalten des Gehirns und des Rückenmarks sowie in die Hirnventrikel ein und bildet dort Gefäßhüllen.
Die Interthekalräume, die Hirnventrikel und der zentrale Spinalkanal sind mit Liquor cerebrospinalis gefüllt interne Umgebung Gehirn und schützt es vor schädliche Auswirkungen, reguliert den Hirndruck, übt eine Schutzfunktion aus. Es entsteht Flüssigkeit. Hauptsächlich im Gefäßmantel der Herzkammern mündet es in das Venenbett. Normalerweise ist seine Menge konstant.
Gefäße des Gehirns und des Rückenmarks. Die Blutversorgung des Rückenmarks erfolgt über Äste, die von den Wirbel-, Interkostal-, Lenden- und Kreuzbeinarterien ausgehen. Im Wirbelkanal bilden sie Spinalarterien, die in den Furchen und Zentralspalten des Rückenmarks verlaufen. Das Blut gelangt über die Wirbelarterien und die innere Halsschlagader (bei Rindern durch die innere Kieferarterie) zum Gehirn.