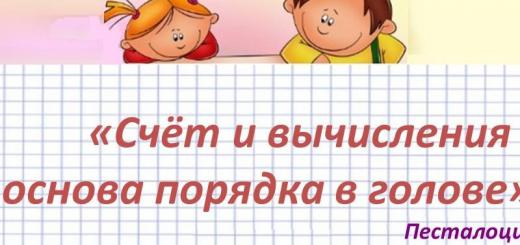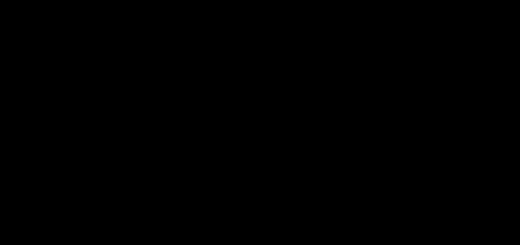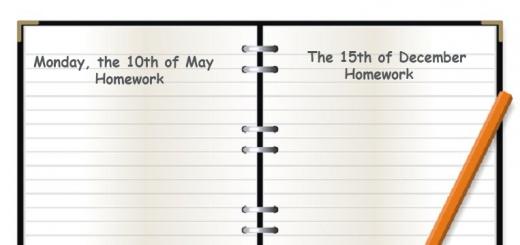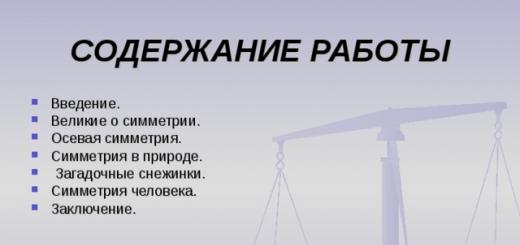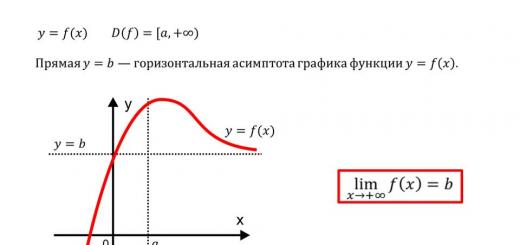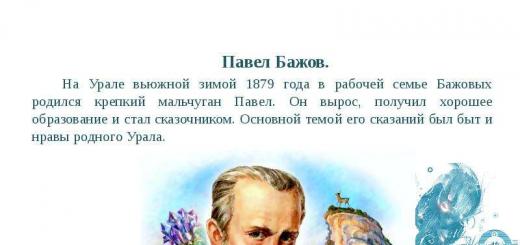Handwerkliche Produktion und Handwerksbetriebe
Es ist schwer, Gründe zu nennen, die den Einsatz von Handwerksberufen in ländlichen Gebieten und Dörfern verhindern würden – wie dies zunächst auch der Fall war. Aber die wachsenden Städte boten natürliche Märkte für alle Arten von Handwerksprodukten: Textilien, Kleidung, Schuhe, alle Arten von Leder- und Metallprodukten und vor allem für den Bau von Privathäusern, Stadtmauern, Türmen und Kirchen. Es ist ganz natürlich, dass Städte für Handwerker attraktiv waren. Mit Ausnahme der Ziegelmacher, Maurer und Vertreter einiger anderer Berufe arbeiteten andere von zu Hause aus und beschäftigten oft Tagelöhner – Lehrlinge und Facharbeiter. Aus dem 12. Jahrhundert oder noch früher begannen sich Vertreter desselben Berufsstandes zu Handwerksbetrieben zusammenzuschließen. Diese Werkstätten waren nicht wie moderne Gewerkschaften, da sie sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer umfassten und der Ton immer von Arbeitgebern – qualifizierten Handwerkern – vorgegeben wurde. Die Zünfte verabschiedeten ihre Satzungen und erstellten schriftliche Berichte über ihre Tätigkeit, was nicht zuletzt der Grund dafür war, dass Historiker ihre Bedeutung oft überschätzten.
Im XII. und XIII. Jahrhundert. Handwerkszünfte waren in der Regel nur religiöse Bruderschaften, deren Mitglieder gemeinsame wirtschaftliche Interessen hatten; Diese Vereine gaben den Menschen das Gefühl von Vertrauen und Sicherheit zurück, das sie verloren hatten, als sie das Dorf verließen, und schufen auch dringend benötigte Einrichtungen zur Betreuung behinderter oder älterer Zunftmitglieder, Witwen und Waisen. Ohnehin könnte eine Werkstatt nur in einer Großstadt gegründet werden, da es in einer Kleinstadt einfach nicht genügend Handwerker eines Berufs geben würde. In Großstädten wie London gab es Vereinigungen der seltensten Handwerke. Der Beschluss der Werkstatt der Spornhandwerker aus dem Jahr 1345 gibt einen klaren Überblick über die Regelung ihrer Tätigkeit, das laute und teilweise gefährliche Verhalten der Stadtbewohner und die ständige Brandgefahr in der mittelalterlichen Stadt:
Erinnern wir uns alle daran, dass am Dienstag, dem Tag nach dem Tag der Fesseln des Hl. Peter, im neunzehnten Regierungsjahr von König Edward III. wurden die hier unterzeichneten Artikel in Anwesenheit von John Hammond, dem Bürgermeister, verlesen ... Erstens sollte keiner der Sporenmacher länger als von Anfang an arbeiten des Tages bis zum Signal zum Löschen der Lichter der Grabeskirche, die sich hinter dem Neuen Tor befindet. Denn nachts kann niemand so genau arbeiten wie tagsüber, und viele Handwerker, die wissen, wie sie ihr Handwerk täuschen können, wollen nachts mehr arbeiten als tagsüber: Dann kann es passieren, dass sie in unbrauchbarem oder rissigem Eisen ausrutschen. Darüber hinaus laufen viele Spornhandwerker den ganzen Tag umher und üben ihr Handwerk überhaupt nicht aus, und wenn sie betrunken sind und durchdrehen, machen sie sich an die Arbeit, wodurch sie den Kranken und allen Nachbarn Angst machen und auch die Streitereien beunruhigen passieren zwischen ihnen... Und wenn sie das tun, schüren sie die Flammen so sehr, dass ihre Schmieden sofort mit einer hellen Flamme zu glühen beginnen, und sie schaffen eine große Gefahr für sich selbst und für alle ihre Nachbarn... Außerdem ist keines der oben genannten- Die genannten Meister sollten ein Haus oder eine Werkstatt zur Ausübung ihres Gewerbes unterhalten (es sei denn, er ist kein Bürger der Stadt). Außerdem sollte keiner der genannten Meister bis zum Ablauf der Amtszeit den Lehrling, Gehilfen oder Gesellen eines anderen Meisters dieses Handwerks einladen Die zwischen ihm und seinem Herrn vereinbarte Vereinbarung ist abgelaufen... Außerdem sollte kein Ausländer dieses Handwerk erlernen oder ausüben, es sei denn, er hat eine städtische Lizenz vom Bürgermeister, Stadtrat und Vorsitzenden des Hauses erhalten...“
Nach und nach, aber nicht überall, wurden in den Zünften Regeln etabliert, die die Bedingungen für die Einstellung von Studenten, die Arbeitszeit, die Qualität der Produkte und manchmal sogar die Preise festlegten.
Kapitalismus in der handwerklichen Produktion
Dieses Produktionssystem funktionierte dort gut, wo die Rohstoffquellen und der Markt für Kunsthandwerk lokal, begrenzt und bekannt waren. Aber dort funktionierte es nicht mehr, wo die Produktion hochwertiger Güter für eine begrenzte Nachfrage importierte Rohstoffe erforderte oder wo Güter an einen breiten Markt geliefert wurden. Also im 13. Jahrhundert. Sowohl flämische als auch italienische Tuchmacher exportierten hochwertige Wolle aus England, und lokale Spinner und Weber mussten sie von Zwischenhändlern kaufen. Da es teuer war, waren sie wahrscheinlich gezwungen, es auf Kredit aufzunehmen, waren verschuldet und von Handelsimporteuren abhängig. Aber viel häufiger nahmen sie Kredite von Exporteuren auf, die fertige Stoffe verkauften, da sie aufgrund der Natur ihres Handwerks keinen Kontakt zum Endkäufer hatten. Im Gegenzug fanden es die Kaufleute – die einzigen, die über Kapital und die Technologie des Kaufens und Verkaufens verfügten – bequem und profitabel, die Produktion von Stoffen entsprechend den vorherrschenden Marktbedingungen zu organisieren. Bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Diese Praxis entwickelte sich im Rahmen der damals fortgeschrittenen „vertikalen Integration“ zu einer hochentwickelten und gut organisierten kapitalistischen Produktion.
In den Geschäftsbüchern eines gewissen Jehan Boyenbrock aus der flämischen Stadt Douai aus den 1280er Jahren steht, dass er in England Agenten hatte, die Rohwolle kauften, die er dann nacheinander an Kardierer, Spinner, Weber, Walker und Färber verteilte führten ihre Arbeit zu Hause aus und verkauften am Ende des Zyklus den fertigen Stoff an ausländische Händler. Die von ihm eingestellten Handwerker hatten kein Recht, Aufträge von anderen Arbeitgebern anzunehmen, auch wenn Boyenbrock nicht genug Arbeit für sie hatte: Tatsache ist, dass er auch die Häuser dieser Handwerker besaß, die zweifellos Schulden bei ihm hatten. Darüber hinaus saßen Boyenbrock und seine Arbeitgeberkollegen im Stadtrat und verabschiedeten Gesetze und Satzungen, die dieses Ausbeutungssystem öffentlich sanktionierten.
In Norditalien war die Situation ungefähr gleich. In Florenz beispielsweise wurde die Herstellung hochwertiger Stoffe aus englischer Wolle von der Wollgilde kontrolliert, einem Zusammenschluss von Kapitalisten, die sich mit der Herstellung von Stoffen befassten: Sie erteilte Befehle nicht nur an die Bewohner der Stadt selbst, sondern auch der umliegenden Dörfer. Dieses System der Produktionsorganisation wird „Verteilung“ genannt. Die Arbeitgeber befürchteten natürlich, dass auch die Arbeitnehmer ihre eigene Organisation gründen würden. Statuten der Florentiner Wollgilde (arte della lana) ab 1317 war dies ganz eindeutig verboten:
Damit ... die Gilde gedeihen und ihre Freiheit, Macht, Ehre und Rechte genießen kann, und um diejenigen zurückzuhalten, die aus freien Stücken handeln und gegen die Gilde rebellieren, verfügen wir und erklären, dass kein Mitglied der Gilde sein darf und kein Handwerker ist unabhängiger Arbeiter oder Mitglied einer Gilde – darf nicht, mit welchen Mitteln oder rechtlichen Mitteln, durch Handlung oder Absicht, irgendwelche ... Monopole, Vereinbarungen, Verschwörungen, Vorschriften, Regeln, Gesellschaften, Ligen schaffen, organisieren oder etablieren , Intrigen oder ähnliche Dinge gegen die besagte Zunft, gegen Meister der Zunft oder gegen ihre Ehre, Gerichtsbarkeit, Vormundschaft, Macht oder Autorität, unter Androhung einer Geldstrafe von 200 Pfund kleinen Gulden. Und geheime Spione werden ernannt, um diese Angelegenheiten zu überwachen; Gleichzeitig ist es aber jedem gestattet, öffentlich oder heimlich Anschuldigungen und Denunziationen vorzubringen und erhält dafür die Hälfte der Geldstrafe. Der Name des Informanten wird geheim gehalten.
Tatsächlich handelte es sich um eine Art „gewerkschaftsfeindliches Gesetz“, das ein Strafsystem für unerlaubte Vereinigungen einführte. Der Chronist Giovanni Villani berichtet, dass im Jahr 1338 in der Florentiner Wollindustrie 30.000 Menschen beschäftigt waren, darunter viele Frauen und Kinder, die jährlich etwa 80.000 große Stoffstücke produzierten. In den letzten dreißig Jahren haben sich die Produktionskosten verdoppelt, während die Zahl der produzierenden Unternehmen von 300 auf 200 zurückgegangen ist.
So entwickelte sich in Flandern und Norditalien eine echte kapitalistische Produktionsweise, in der Arbeiter tatsächlich zu Lohnarbeitern wurden, zu Proletariern, die außer ihrer Arbeitskraft nichts besaßen, obwohl es zu dieser Zeit keine Fabriken gab, und die Arbeiter zu Hause arbeiteten und weitermachten Gesellen und Lehrlinge einzustellen. Die Beschäftigung der Arbeiter hing von Schwankungen auf dem internationalen Markt ab, von denen die Arbeiter selbst nichts wussten und die sie nicht kontrollieren konnten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass in diesen beiden Gebieten Arbeitskonflikte – Streiks und städtische Aufstände – begannen. Wenn sie mit Bauernaufständen zusammenfielen oder mit ihnen verbunden waren, konnten sie, zumindest manchmal, sehr gefährlich sein.
Die Prozesse, die sich bei der Wollproduktion entwickelten, waren auch für andere Industriezweige charakteristisch. Wo die Produktion erhebliches Anlagekapital (z. B. im Bergbau) oder Betriebskapital (z. B. im Bau- und Schiffbau) erforderte, verdrängten Unternehmer und die von ihnen geschaffene kapitalistische Organisation unaufhaltsam kleine unabhängige Handwerker. Dieser Prozess verlief langsam, nicht überall gleichzeitig und betraf in dieser Zeit nur einige Gebiete Europas und einen relativ kleinen Teil der arbeitenden Bevölkerung. Aber das XIII. und XIV. Jahrhundert. wurde zum Wendepunkt zwischen einer traditionellen Gesellschaft, die sich langsam aus einer Kombination spätrömischer Handwerkskunst und barbarischer Bräuche entwickelte, und der dynamischen, wettbewerbsorientierten und tief gespaltenen modernen Gesellschaft. In dieser Zeit entstanden jene Stereotypen des wirtschaftlichen Verhaltens und der Organisation mit allen begleitenden Problemen menschlicher Beziehungen, die für unsere Tage charakteristisch sind.
Aus dem Buch Mittelalterliches Frankreich Autor Polo de Beaulieu Marie-AnneHandwerk und Handwerksbetriebe Die städtische Handwerksproduktion unterschied sich von der ländlichen Produktion durch eine engere Spezialisierung. Wenn wir das Beispiel der Tuchherstellung nehmen, erkennt man, dass in diesen Prozess etwa zwanzig verschiedene Arbeitsgänge einbezogen wurden, für die
Aus dem Buch Daily Life of Florence in the Time of Dante von Antonetti Pierre Aus dem Buch Alltag in Frankreich im Zeitalter von Richelieu und Ludwig XIII Autor Glagoleva Ekaterina Wladimirowna3. Alle Arbeiten sind gut. König aller Gewerke. – Kunsthandwerksläden. - Metzger und Bäcker. - Apotheker und Lebensmittelhändler. - Chirurgen und Friseure. - Freimaurer. - Büchsenmacher und Arkebusiere. - Schnürer, Sattler, Sticker. - Workshops für Frauen. – Leinen, Wolle und Seide – Schnitt,
Aus dem Buch Geschichte des Mittelalters. Band 1 [In zwei Bänden. Unter der allgemeinen Herausgeberschaft von S. D. Skazkin] Autor Skazkin Sergey Danilovich Aus dem Buch Maya [The Vanished Civilization: Legends and Facts] von Ko MichaelHandwerkliche Produktion und Handel Yucatan war der Hauptlieferant von Salz in Mesoamerika. Salzlager erstrecken sich entlang der gesamten Küste von Campeche und entlang der Lagunen auf der Nordseite der Halbinsel bis hin zur Isla Mueros im Osten. Das Salz, das Diego de Landa
Aus dem Buch Geschichte Roms (mit Abbildungen) Autor Kovalev Sergey Ivanovich Aus dem Buch Geschichte der Geheimbünde, Gewerkschaften und Orden Autor Schuster GeorgFRANZÖSISCHE HANDWERKSGEWERKSCHAFTEN Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich schlossen sich möglicherweise zu Beginn des 16. Jahrhunderts Vertreter des Handwerks in geschlossenen Gewerkschaften zusammen. Aber hier zeigte sich schon früh eine scharfe, ja sogar feindselige Spaltung zwischen den Meisterzünften und den Lehrlingsverbänden. Während das erste
Aus dem Buch Geschichte des Byzantinischen Reiches. Werden Autor Uspenski Fjodor IwanowitschKapitel VIII Konstantinopel. Die Weltbedeutung der Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Eparch der Stadt. Bastelkurse. Dima. Bildungseinrichtungen Rom war für das westliche Reich nicht so wichtig wie Konstantinopel für das östliche. Die Hauptstadt des Weströmischen Reiches könnte darin gewesen sein
Aus dem Buch Geschichte Roms Autor Kovalev Sergey IvanovichHandwerkliche Produktion Der allgemeine Trend in der Entwicklung der Produktion in den ersten beiden Jahrhunderten des Reiches war ihr Wachstum in den Provinzen (insbesondere in den westlichen) und ein langsamer Niedergang in Italien. Dieser Prozess war jedoch aufwändig und kann nicht vereinfacht werden. Am Ende der Republik erfolgte die handwerkliche Produktion
Aus dem Buch Slawische Altertümer von Niderle LuborKapitel IX Handwerk Bisher haben wir über eine Art von Hausarbeit gesprochen, deren Ziel die Gewinnung von Nahrungsmitteln war. Eine andere, ebenso alte Art bezog sich auf die Gewinnung von Rohstoffen und die Herstellung von Haushaltsgegenständen, die für die Wirtschaft notwendig sind. Zweifellos
Aus dem Buch Petersburger. Russischer Kapitalismus. Erster Versuch Autor Lurie Lew JakowlewitschKapitel 5 Handwerksartikel
Aus dem Buch Altes Moskau. XII-XV Jahrhunderte Autor Tichomirow Michail NikolajewitschMOSKAUER HANDWERK SLOBODA Der mittelalterliche Brauch, dass sich Handwerker in getrennten Vierteln (auf Russisch „Siedlungen“) niederließen, ist in Westeuropa und Russland weit verbreitet. Dieser Brauch spiegelte sich im Leben Moskaus im 14.-15. Jahrhundert wider. Im Jahr 1504, in der Nähe einer Schlucht mit Blick auf
Aus dem Buch Celtic Civilization and Its Legacy [bearbeitet] von Philip YangEigenproduktion und anschließende Massenproduktion. Ausgewählte Fertigungssektoren Es könnten viele weitere Fertigungssektoren erwähnt werden, die von der hochwertigen Eigenproduktion bis hin zur groß angelegten organisierten Massenproduktion reichen.
Aus dem Buch Dagestan Shrines. Buchen Sie eins Autor Shikhsaidov Amri RzaevichHauptdörfer, Verwaltungs-, Handels- und Handwerkszentren. Ländliche Gewerkschaften
Aus dem Buch Dagestan Shrines. Buch zwei Autor Shikhsaidov Amri Rzaevich Aus dem Buch Kunst und Schönheit in der mittelalterlichen Ästhetik von Eco Umberto10.3. Freie und handwerkliche Künste Wenn im Mittelalter das Ästhetische mit dem Künstlerischen verschmilzt, so ist die Idee des Künstlerischen selbst in dieser Zeit kaum entwickelt. Mit anderen Worten, dem Mittelalter fehlte die Theorie der Schönen Künste, die Idee davon
Die ersten Werkstätten entstanden fast zeitgleich mit den Städten selbst: in Italien – bereits im 10. Jahrhundert. in Frankreich, England, Deutschland - vom 11. bis frühen 12. Jahrhundert. Unter den frühen Werkstätten ist beispielsweise die 1061 entstandene Pariser Kerzenmacherwerkstatt bekannt.
Vor allem im Mittelalter gab es Werkstätten, die sich mit der Herstellung von Nahrungsmitteln beschäftigten: Werkstätten von Bäckern, Müllern, Brauern, Metzgern.
Viele Werkstätten beschäftigten sich mit der Herstellung von Kleidung und Schuhen: Werkstätten von Schneidern, Kürschnern und Schuhmachern. Eine wichtige Rolle spielten auch Werkstätten, die sich mit der Verarbeitung von Metallen und Holz befassten: Werkstätten von Schmieden, Tischlern und Tischlern. Es ist bekannt, dass sich nicht nur Handwerker in Gewerkschaften zusammenschlossen; Es gab Zünfte von Stadtärzten, Notaren, Gauklern, Lehrern, Gärtnern und Totengräbern.
Eine Gilde ist ein Zusammenschluss von Handwerkern gleicher oder verwandter Fachrichtungen in einer mittelalterlichen europäischen Stadt. Mittelalterliche Städte entstanden und wuchsen als Zentren des Handwerks und Handels.
Lange Zeit gab es nur wenige Käufer von Kunsthandwerksprodukten. Einen Käufer oder Kunden zu gewinnen galt als großer Erfolg.
Aus diesem Grund konkurrierten städtische und ländliche Handwerker. Der Handwerkerverband konnte nicht nur Fremde vom städtischen Markt vertreiben, er garantierte auch qualitativ hochwertige Produkte – der Haupttrumpf im Kampf gegen Konkurrenten. Gemeinsame Interessen veranlassten die Handwerker, Gewerkschaften namens „Zünfte“ zu gründen.
Ordentliche Mitglieder der Zünfte waren nur Meister, die in ihren eigenen Werkstätten zusammen mit Lehrlingen und Lehrlingen arbeiteten, die ihnen halfen. Das wichtigste Leitungsgremium der Werkstatt war die Generalversammlung der Handwerker. Es verabschiedete die Geschäftssatzung und wählte Vorarbeiter, die die Einhaltung der Geschäftsordnung überwachten.
Es sind die Ladenordnungen, die es uns ermöglichen, viel über die Struktur und das Leben der Geschäfte zu erfahren. Die Ladenregeln waren besonders streng. Ihr Ziel war es, die höchste Qualität der Produkte aufrechtzuerhalten.
Ein weiteres wichtiges Anliegen der Zünfte war die Wahrung der Gleichberechtigung ihrer Mitglieder. Um zu verhindern, dass sich einige Handwerker auf Kosten anderer bereichern, wurden in der Werkstattordnung gleiche Bedingungen für alle Handwerker bei der Herstellung und dem Verkauf von Produkten festgelegt. Jede Werkstatt legte für ihre Mitglieder die Größe der Werkstatt, die Anzahl der darin aufgestellten Geräte und Maschinen sowie die Anzahl der berufstätigen Lehrlinge und Lehrlinge fest.
Die Zunftordnung legte fest, wie viel Material der Meister für seine Werkstatt erwerben durfte (z. B. wie viele Stoffstücke ein Schneider kaufen durfte). In einigen Werkstätten, für deren Herstellung teure oder seltene importierte Materialien erforderlich waren, wurden Rohstoffe kollektiv eingekauft und gleichmäßig unter den Gewerkschaftsmitgliedern verteilt. Den Meistern war es verboten, sich gegenseitig ihre Lehrlinge und Kunden anzulocken.
Zusammenschluss eines oder mehrerer verwandter Berufe, um deren Interessen zu schützen und sicherzustellen, dass die Mitglieder der Werkstatt ein Monopol auf den Verkauf und die Herstellung handwerklicher Produkte haben. In Russland wurde das Zunftsystem 1722 eingeführt und 1917 abgeschafft.
Hervorragende Definition
Unvollständige Definition ↓
GESCHÄFT
Vereinigungen, die auf den Berufen von Handwerkern basierten, die kleine, wirtschaftlich unabhängige Produzenten in feudalen Städten waren. Gesellschaft. In der Geschichte Wissenschaftsdauer Damals wurde der Begriff Ts. nur in Bezug auf die westliche Geschichte verwendet. und Zentrum. Europa, wo C. seine größte Entwicklung erreichte, sowie zur Geschichte des polnisch-litauischen Staates und des nachpetrinischen Russlands (siehe unten – C. in Russland). Allerdings in modern ist. In der Wissenschaft (besonders im Sowjetischen) wird der Begriff „C“ verwendet. oft an Bergorganisationen verteilt. Handwerker aller Fehden. Länder (einschließlich Länder Asiens und Nordafrikas). Workshops in westlichen Ländern. Europa (deutsch Zunft, Amt, Gilde, Handwerk, Zeche, Einung; französisch corps de metier, Korporation; englisch Guild, Craftguild; italienisch arte, corporazione) entstand in der frühen Phase der Entstehung des Mittelalters. Städte - in Frankreich, England, Deutschland im 11.-12. Jahrhundert. (in Italien vielleicht sogar früher); volle Entwicklung in den meisten westlichen Ländern. Sie gelangten im 13.-14. Jahrhundert nach Europa. Zu dieser Zeit waren in den meisten Städten (aber nicht in allen) Handwerker der Hauptspezialitäten im Zentrum vereint (das Zentrum der Schmiede, Büchsenmacher, Weber, Fuller, Bäcker, Metzger, Tischler, Gerber usw.); Darüber hinaus galt die Mitgliedschaft im Zentrum nicht automatisch für alle Personen in einem bestimmten Fachgebiet, sondern wurde individuell erworben. In C. herrschte eine gewisse soziale Hierarchie: Meister, Geselle, Schüler. Die Handwerker führten selbstständig ihr eigenes Geschäft – sie arbeiteten in ihrer Werkstatt, waren Eigentümer von Werkzeugen, Rohstoffen und Industriegütern; Nur die Meister waren Vollmitglieder des C. Arbeiter, die vom Meister eingestellt wurden (Lehrlinge), und die Lehrlinge waren keine Vollmitglieder des C. Um Meister zu werden, musste man eine bestimmte Lehrzeit absolvieren (in in verschiedenen Städten und C. sie lag zwischen 2-3 und 7 oder mehr Jahren) und arbeitete einige Zeit als Lehrling. Die Lehrlinge waren von den Meistern abhängig und wurden von ihnen ausgebeutet. Die Entstehung des Handels aufgrund der gemeinsamen Interessen der Handwerker als Kleinproduzenten war Ausdruck eines charakteristischen Merkmals aller Gesellschaften. feudale Struktur Gesellschaft (und besonders deutlich ausgedrückt in der westeuropäischen Version des Feudalismus) Korporatismus. Von den Bewohnern Westeuropas erobert. Städte der Freiheit und Selbstverwaltung erleichterten sowohl die Vereinigung der Handwerker im C. als auch ihre Aktivitäten. Basic Die Funktionen von C. sind wirtschaftlicher Natur. In den meisten Fällen kämpfte das C. für die Gründung der sogenannten. Zunftzwang, also die Anerkennung des Monopolrechts ihrer Mitglieder auf die Herstellung und den Verkauf dieser Art von Handwerk. Produkte innerhalb der Stadt oder ihrer Umgebung, die hauptsächlich durch verursacht wurde. die Enge des Marktes, die für eine feudale Wirtschaft charakteristisch ist. Gesellschaft, begrenzte Nachfrage nach Kunsthandwerk. Produkte. Das C. regelte auch die Produktion und Vermarktung von Kunsthandwerk. Produkte, um günstigere Bedingungen für Haushalte zu schaffen. Aktivitäten der Mitglieder des Zentralkomitees und zur Beseitigung der Konkurrenz in ihrem Umfeld. Die Zunftordnung bestimmte die Zeit und die Arbeitsbedingungen der Meister und Lehrlinge sowie die Qualität der Rohstoffe, aus denen das Handwerk hergestellt werden sollte. Produkte, Produktionstechnik. Prozess, Qualität, Menge der fertigen Produkte (z. B. Breite, Dichte, Färbung, Veredelung von Wollstoffen), Ort und Bedingungen für den Einkauf von Rohstoffen und den Verkauf von fertigen Waren, Ausbildungsbedingungen, Anzahl der Auszubildenden und Maschinen dass man jeden Meister und andere Ts in seiner Werkstatt haben konnte. versuchte, Handwerker vor der Ausbeutung durch Herren, Kaufleute und Geldverleiher zu schützen. Trotz der ausgleichenden Tendenzen der Werkstattregulierung eröffnete die kleinteilige Warenproduktion gewisse Möglichkeiten für Eigentum. Bündel. In großen Bergen. Zentren, insbesondere in Branchen, die mit der Produktion einer großen Anzahl von Handwerken verbunden sind. Produkte für den Export (Florenz, Gent, Brügge) erreichte diese Schichtung bereits im 13.-14. Jahrhundert erhebliche Ausmaße. Innerhalb des C. stachen mehr und weniger wohlhabende Herren hervor. Es gab auch eine Schichtung zwischen den Zentren, die Handwerker verschiedener Fachrichtungen vereinten: Einige Zentren wurden tatsächlich zu Unternehmerorganisationen, die Arbeiten an Handwerker aus anderen Zentren verteilten (ein besonders auffälliges Beispiel sind C. Lana und Kalimala in Florenz). Wie andere Mittelalter. Als Korporationen dehnten die C. ihren Einfluss auf alle Aspekte des Lebens ihrer Mitglieder aus: Sie überwachten die Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln durch die Handwerker, organisierten gegenseitige Hilfe und gemeinsame Feiern und fungierten als Zellen der Berge. Milizen hatten ihre eigenen „heiligen“ Gönner und traten gemeinsam in Religionen auf. Prozessionen usw. Jedes C. hatte sein eigenes Emblem mit der Abbildung von Werkzeugen, einem Werkstattsiegel und einer Registrierkasse. Ts. strebten in der Regel das Recht an, über ihre inneren Angelegenheiten selbst zu entscheiden. Angelegenheiten unter der allgemeinen Aufsicht der Berge. Behörden (manchmal hatten sie auch ein eigenes Gericht). Die Leitungsgremien im C. waren Versammlungen der ordentlichen Mitglieder des C., es gab gewählte Beamte – Älteste und Geschworene. Älteste wurden oft vom Herrn einer Stadt oder eines anderen Berges ernannt. Behörden, aber auch in diesen Fällen beteiligten sich Mitglieder des Zentralkomitees aktiv an der Leitung des Zentralkomitees – sie versammelten sich zu Hauptversammlungen, genehmigten Geschäftsordnungen usw. Das Zentralkomitee spielte eine herausragende Rolle im sozialen Kampf innerhalb der Stadt . Ts. schützt die Interessen breiter Schichten von Handwerkern. führte den Kampf gegen die Berge. Patriziat und in einer Reihe von Städten (normalerweise dort, wo es ein hochentwickeltes Handwerk gab, das den vorherrschenden Zweig der städtischen Wirtschaft darstellte), nachdem sie die Macht des Patriziats gestürzt hatten, übernahmen sie die Kontrolle über die Stadt in ihre eigenen Hände (Florenz, Köln). , Gent usw.). Die Früchte des Sieges wurden jedoch meist nur von den meisten genossen. reich und einflussreich. C. Die spezifischen Formen von C. – ihre Organisation, Funktionen usw. – waren äußerst vielfältig und veränderten sich entsprechend den sozioökonomischen Merkmalen. und politisch Aufbau einzelner Länder; Sie waren auch von der Wirtschaft abhängig. der Charakter der Stadt (aus der Vorherrschaft der Industrie oder des Handels darin), aus dem Industriezweig, in dem die Werkstatt entstand. Organisation usw. Es gab Zentren, die keine Lehrlinge hatten (z. B. in Italien) und keine Lehrausbildung erforderten (z. B. bestimmte Brüsseler Zentren). Es gab große Unterschiede zwischen den C. im Grad ihrer Unabhängigkeit gegenüber den Bergen. Behörden und gegenüber dem Staat. In einigen Fällen genossen die Kirchen weitgehende Autonomie und wurden von gewählten Amtsträgern geleitet, in anderen standen sie unter der strengen Aufsicht des Staates. Organe oder Berge Behörden (in zentralisierten Staaten war die Autonomie der Zentralregierung in der Regel enger als in dezentralen Staaten – in Frankreich war sie beispielsweise enger als in Deutschland). Es gab erhebliche Unterschiede in der Verbreitung der Farbgebung in verschiedenen Ländern oder sogar in verschiedenen Bezirken und Städten (z. B. war in Nordfrankreich das Zunfthandwerk weiter verbreitet und die Farbgebung erreichte eine größere Entwicklung als in Südfrankreich). C. spielte in der Anfangsphase der Entwicklung eine fortschrittliche Rolle. Sie stärkten die Wirtschaft. und der rechtliche Status von Handwerkern; Die Anweisungen von Ts. zur Einhaltung bestimmter Regeln der Produktionstechnik, zur Ausbildung von Studierenden, zu den Anforderungen an die Qualifikation von Handwerkern trugen zur Entwicklung der Technik und zur Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten bei. Handwerkskunst. Die Existenz und weite Verbreitung von Farben in ihren am weitesten entwickelten Formen war eine der Hauptbedingungen für eine rasche wirtschaftliche Entwicklung. Aufstieg westlicher Länder Europa im 12.-15. Jahrhundert. Doch im 16.-18. Jahrhundert, unter den Bedingungen der Entstehung des Kapitalismus, wurden die Preise zu einer Bremse auf dem Weg der Wirtschaft. Entwicklung: Unterstützung und Schutz kleiner Handwerke. Produktion behinderten sie die Entwicklung neuer Kapitalisten. Formen der Landwirtschaft. Führende Rolle im technischen Bereich und wirtschaftlich Die Entwicklung verlagerte sich auf neue Produktionsformen - den heimischen Kapitalismus. Industrie und Fertigung. In dieser Zeit kam es zu einem Niedergang und Zerfall des Zunftwesens. Die Organisation der Zentren und ihre Funktionen veränderten sich erheblich. Die soziale Grenze zwischen Meistern und Lehrlingen verschärfte sich. Im Wettbewerb mit fortschrittlicheren Industriezweigen versuchten die Zunftmeister, ihre Position zu behaupten, indem sie sich in eine geschlossene, privilegierte Klasse verwandelten, und machten es Lehrlingen immer schwerer, Mitglieder der Zentrale zu werden. , wodurch sie hohe Beträge zahlen müssen. Beiträge, die Aufführung spezieller komplexer Werke (das sogenannte Meisterwerk) usw. - es fand ein Prozess des „Schließens“ oder „Schließens“ des C statt. Die Ausbeutung von Lehrlingen intensivierte sich. All dies führte zu einer Verschärfung des Kampfes zwischen Meistern und Lehrlingen, zur Umwandlung von Lehrlingsgewerkschaften in Kampforganisationen gegen Meister (siehe Gefährten). Aus Gesellen und Lehrlingen wurden faktisch Lohnarbeiter, die nur sehr geringe Chancen hatten, jemals zum Meister aufzusteigen. C. in Mitteln. Abschlüsse verloren das Recht auf Selbstverwaltung und unterlagen einer ständigen und kleinlichen Kontrolle und steuerlichen Ausbeutung durch den Staat. Mit der Gründung entwickelter Kapitalisten Beziehungen, die die Anerkennung des Prinzips des freien Kapitalismus mit sich brachten. Durch Unternehmertum und Konkurrenz wurde das Zunftwesen auch in den Industriezweigen zerstört, in denen noch kleine Handwerke erhalten blieben. Produktion In Frankreich wurde das Handwerk 1791 während der Großen Französischen Revolution abgeschafft, in Deutschland alle Einschränkungen der Handwerksfreiheit. Die Aktivitäten der Zentralregierung wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts durch eine Reihe von Gesetzen abgeschafft. (endlich 1868). Geschichte Westeuropas Eine umfangreiche Literatur ist C gewidmet. Im 19. – ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Einen großen Platz nahm darin das Problem der Entstehung der Farbe ein. Einig in der Erkenntnis, dass die Entstehung der Farbe mit der Entwicklung des Mittelalters verbunden war. Städte und Berge Handwerke, Historiker waren sich nicht einig darüber, welche Rechtsinstitutionen und Organisationen als Ausgangspunkt für die Entwicklung von C. dienten, und daher entwickelten sich verschiedene Theorien über ihren Ursprung: aus Rom. Kollegien, aus Vereinigungen patrimonialer Handwerker (eine Art Patrimonialtheorie - K.V. Nich, R. Eberstadt usw.), die Theorie der Organisation von C. Mountains. Behörden, um das Handwerk zu kontrollieren (F. Keutgen), ist die Theorie unabhängig. die Entstehung der Stadt als Ergebnis der freien Vereinigung von Handwerkern unter dem Einfluss der neuen Bedürfnisse der Berge. Leben (G. Belov und andere) (letztere Theorie hat in der modernen Geschichtswissenschaft breite Anerkennung gefunden). Mn. Historiker und Ökonomen des 19. Jahrhunderts. (zum Beispiel K. Schönberg) idealisierte die Hauptstädte der ersten Periode ihrer Entwicklung (vor dem 16. Jahrhundert) und glaubte, dass ihnen zu dieser Zeit Phänomene wie scharfes Eigentum fremd seien. Schichtung unter den Meistern, grausame Ausbeutung von Lehrlingen, ein Geist roher Exklusivität, der sich in dem Wunsch manifestiert, die Aufnahme neuer Mitglieder in die Kirche zu erschweren usw.; Ihrer Meinung nach werden all diese Phänomene erst in der nächsten Entwicklungsstufe des Workshops offenbart. Gebäude, das seinen Niedergang markierte (im 16.-18. Jahrhundert). Historiker einer anderen, derzeit vorherrschenden Richtung weisen darauf hin, dass diese Phänomene (insbesondere der Wunsch, die Aufnahme neuer Mitglieder zu erschweren, die Anforderung, ein Meisterwerk zu vollenden, Eintrittsgelder usw. ) waren für C. bereits im 13.-15. Jahrhundert charakteristisch, dass die egalitären Tendenzen der Zunftstatuten dieser Zeit nur teilweise die tatsächliche Geschichte widerspiegelten. Wirklichkeit. Organisation städtischer Kunsthandwerker in Asien und Nordafrika. Wirtschaftlich Lage der Berge Handwerker aus China, Japan, Indien, Staaten in Zentralasien, Iran, arabischen Ländern, dem Osmanischen Reich usw. im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit ähnelten in vielerlei Hinsicht der Wirtschaft. Lage der Berge feudale Handwerker Europa: In den meisten Fällen waren sie auch wirtschaftlich unabhängige Kleinproduzenten, die für einen begrenzten Markt arbeiteten und in einer sozialen Realität lebten, die zu einer unternehmerischen Isolation der Abteilungen führte. soziale Gruppen usw. Das Ergebnis war die Entstehung spezieller sektoraler Bergorganisationen in diesen Ländern. Handwerker. Allerdings haben sie nicht den gleichen Entwicklungsstand wie Westeuropa erreicht. Ts. hatten nicht die gleichen Selbstverwaltungsrechte wie diese und spielten in der Geschichte ihrer Länder eine viel geringere Rolle. Über die Organisationen der Berge. Kunsthandwerker aus asiatischen und nördlichen Ländern. Afrika, siehe Artikel von Dza, Esnaf, Khan. Lit.: Marx K., Capital, Marx K. and Engels F., Works, 2. Aufl., Bd. 23, 25 (Teile 1-2) (siehe Index); Kulisher I.M., Wirtschaftsgeschichte. Alltag Western Europa, M.-L., 1931; Gratsiansky N.P., Pariser Handwerksbetriebe im XIII.-XIV. Jahrhundert, Kasan, 1911; Stoklitskaya-Tereshkovich V.V., Essays zur Sozialgeschichte einer deutschen Stadt im XIV.-XV. Jahrhundert, M.-L., 1936; ihr, Das Problem der Vielfalt der mittelalterlichen Zunft im Westen und in Russland, in der Sammlung: Mittelalter, v. 3, M., 1951; Rutenburg V.I., Essay über die Geschichte des frühen Kapitalismus in Italien..., M.-L., 1951; Polyansky F. Ya., Essays zum Thema Sozioökonomie. Betriebsrichtlinien in westlichen Städten. Europa XIII-XV Jahrhundert, M., 1952; Stam S.M., Wirtschaft. und soziale Entwicklung der frühen Stadt (Toulouse XI-XIII Jahrhundert), Saratov, 1969; Svanidze A. A., Handwerk und Handwerker des mittelalterlichen Schweden, M., 1967; Unten G. Von, Die Motive der Zunfbildung im deutschen Mittelalter, „HZ“, 1912; Lipson E., Die Wirtschaftsgeschichte Englands, v. 1, 8. Auflage, L., 1945; Valsecchi F., Comune e corporazion? nel medio evo Italiano, Mailand, 1949; Pirenne H., Les villes et les institutions urbaines. 2 ?d., t. 1-2, S., 1939; Coornaert E., Les corporations en France avant 1789, P., 1941; Martin Saint Léon E., Histoire des corporations de métiers. Depuis leurs origines Jusqu´b leur suppression en 1791, 4?d., P., 1941; Wernet W., Kurzgefa?te Geschichte des Handwerks in Deutschland, 5 Aufl., V. , 1969; Die Cambridge-Wirtschaftsgeschichte Europas, v. 2-3, Camb., 1952-63 (Bib.). Yu. A. Korkhov. Moskau. Workshops in Russland. Die Frage nach der Existenz einer Zunftorganisation der Handwerker im Mittelalter. Rus‘ ist umstritten. Bereits 1852 vertrat V. N. Leshkov die Meinung über die Existenz des Handwerks. Unternehmen in Russland, aber es fand zu dieser Zeit keine Unterstützung in der Literatur. Im Sov. literarische These über die korporative Natur der Berge. Kunsthandwerk in Antike und Mittelalter. Rus wurde von M. N. Tikhomirov und B. A. Rybakov vorgebracht, die auf die Spezialisierung der Handwerker, ihre gemeinsamen Siedlungen in Siedlungen und Hunderten, die Spezialisierung des Handels in den Reihen nach Produktart, das Vorhandensein von Patronatskirchen und korporativen Festen-Bruderschaften hinwiesen und einige andere. Indirekte Zeichen, die auf die Anwesenheit irgendeiner Art von Handwerkerorganisationen in den Städten Kiewer Rus, Nowgorod und Pskow im 14.-15. Jahrhundert hinweisen. Zwar „haben wir aus Quellen keine direkten Hinweise auf die Existenz von Handwerksbetrieben mit formalisierten Statuten in russischen Städten ...“, aber „die allgemeine Situation für die Entwicklung des städtischen Handwerks (Grad der Differenzierung, technische Ausstattung, Beteiligung von Handwerkern an städtische Selbstverwaltung, heftiger Klassenkampf) ermöglicht den Vergleich der größten russischen Städte des 14.-15. , 1948, S. 775-76). V. V. Stoklitskaya-Tereshkovich bemerkte: „Es ist falsch, sich die Werkstattorganisation aller Länder, Städte und Branchen nach dem Typus der deutschen Werkstattorganisation vorzustellen, der am besten untersuchten und bekanntesten... Von großer Bedeutung ist... die.“ Natur der Staatsmacht und -struktur, insbesondere Grad der Staatszentralisierung. In zentralisierten Staaten ist die Autonomie der Werkstatt in der Regel enger als in dezentralisierten Staaten“ („Das Problem der Vielfalt der mittelalterlichen Werkstatt im Westen und in Russland“, siehe Sammlung „Mittelalter“, Bd. 3, 1951, S. 102). A. M. Sacharow, der den Nordosten studierte. rus. Städte des 14.-15. Jahrhunderts kamen zu dem Schluss, dass „... einige Elemente der Zunftorganisation überall dort stattgefunden haben müssen, wo der Feudalismus herrschte. Daher ist es möglich, das Vorhandensein dieser Elemente in russischen Städten anzunehmen“, aber am Gleichzeitig.“ ..In Russland im 14.-15. Jahrhundert wurden in der spezifischen historischen Situation des intensiven Kampfes mit den tatarisch-mongolischen Invasoren und der kontinuierlichen Stärkung der zentralisierenden großherzoglichen Macht keine Bedingungen für die Existenz von Zünften geschaffen in ihren entwickelten und vollständigen Formen“ („Städte des XIV.-XV. Jahrhunderts im Nordosten Russlands“, 1959, S. 143). Mit der Bildung eines einheitlichen russischen Staates im 16.-17. Jahrhundert. Die Feudalherrschaft wurde gestärkt. Staat über die Stadt und blieb lange bestehen. spezifische Schwere der Fehde. Besitztümer. Unter diesen Bedingungen hatten korporative Organisationen von Handwerkern in Form von Siedlungen und Hundertschaften einen äußerst begrenzten Spielraum für ihre Entwicklung; Der Staat legte Abstufungen der Fähigkeiten der Palasthandwerker fest. Macht und ihre privilegierte Stellung trennten sie künstlich von der Masse der Berge. Handwerker. Elemente der Zunftstruktur des Handwerks im Mittelalter. Rus. state-ve wurden vom Staat brutal reguliert. Macht und den Interessen der Fehde untergeordnet. Zustand Der Leibeigenengeist. Beziehungen drangen tief in die Berge vor. Leben, einschließlich der Beeinflussung der Organisation von Bergen. Kunsthandwerk. Vergleiche bestimmter ausländischer Russische Reisende Handwerksassoziationen mit Farbe basieren auf rein äußerlichen Ähnlichkeiten bestimmter Handwerkselemente. Organisationen und spiegeln nicht die tatsächliche Natur dieser Vereinigungen wider (P. I. Lyashchenko). Im Jahr 1722 gründete Peter I. in Russland eine Zunftstruktur des Handwerks, um die Zunftorganisationen besser zur Befriedigung staatlicher Bedürfnisse als Pflichtdienst zu nutzen. Das Zentrum nahm freie Menschen sowie von ihren Besitzern freigelassene Leibeigene auf, um Geld zu verdienen. Die Lehrzeit wurde auf 7 Jahre festgelegt, bei Ausübung des Gesellengrades auf mindestens zwei Jahre. Sowohl der Eintritt in die Werkstatt als auch die Verleihung des Meistertitels setzten die Erfüllung einer bestimmten Qualifikationsaufgabe voraus. Im Jahr 1785 wurde die Bildung von „Lehrlingsausschüssen“ vorgeschrieben, in denen von den Lehrlingen gewählte Personen zur Mitwirkung bei Entscheidungen über die Lehrlingsangelegenheiten gewählt wurden, was in der Praxis jedoch keine Bedeutung hatte. Die Stellung von Lehrlingen und Lehrlingen in der Leibeigenschaft. und kapitalistisch Russland war machtlos. Die zunftliche Organisationsform des Handwerks eröffnete im Kapitalismus Spielraum für die Willkür der Meister und die grenzenlose Ausbeutung von Gesellen und Lehrlingen. Mit dem Sieg von Vel wurde die Zunftorganisation abgeschafft. Okt. sozialistisch Revolution. Lit.: Peshkov V.N., Essay über alte russische Gesetze zum Handwerk und zur Fabrikindustrie, „Moskvityanin“, 1852, Nr. 23; Tikhomirov M. N., Old Russian Cities, 2. Auflage, M., 1956; Lyashchenko P.I., Geschichte der Volkswirtschaft der UdSSR, 3. Aufl., Bd. 1, M., 1952; Rybakov B. A., Craft of Ancient Rus', M., 1948; Pajitnov K. A., Das Problem der Handwerksbetriebe in der Gesetzgebung des russischen Absolutismus, M., 1952; Sacharow A. M., Städte des XIV.-XV. Jahrhunderts im Nordosten Russlands, M., 1959; PSZ, Bd. 6 (Nr. 3708), Bd. 7 (Nr. 4624), St. Petersburg, 1830. A. M. Sacharow. Moskau.
Workshops (Deutsche Singular Zunft, Zeche)
In den Städten der feudalen Gesellschaft gab es Organisationen, die auf den Berufen der Handwerker basierten, die kleine, wirtschaftlich unabhängige Produzenten waren. C. in westeuropäischen Ländern. Die am weitesten entwickelten Organisationsformen städtischer Handwerker entwickelten sich in den Ländern Westeuropas, wo die Bevölkerung mittelalterlicher Städte weitreichende Selbstverwaltungsrechte erlangte (siehe Stadt). Die von den Bürgern erlangten Rechte erleichterten sowohl die Vereinigung der Handwerker im Zentrum als auch die Entwicklung bereits etablierter Geschäfte. Kunsthandwerk entstand im 11. und 12. Jahrhundert in Frankreich, Deutschland und England. (in Italien vielleicht sogar früher) und erreichte im 13.-14. Jahrhundert seine volle Entwicklung. Zu dieser Zeit waren in den meisten Städten Westeuropas Handwerker verschiedener Fachrichtungen im Zentrum vereint (das Zentrum der Weber, Tuchmacher, Tuchfärber, Schuhmacher, Gerber, Handwerker, die verschiedene Metallprodukte herstellten, Tischler, Bäcker, Metzger, usw. entstanden). . Die Bildung von C. war mit der für die westeuropäische Feudalgesellschaft charakteristischen Tendenz zur korporativen Isolation einzelner sozialer Gruppen verbunden. In Zentralasien waren nicht nur Handwerker, sondern auch andere Schichten der städtischen Bevölkerung organisiert: Einzelhändler verschiedener Spezialitäten, Fischer, Gärtner, Ärzte, Musiker usw.; Auch die Kaufleute waren in besonderen, dem C. nahestehenden Korporationen zusammengeschlossen (siehe Zünfte).
Nur Handwerker, die selbständig ihre eigenen Höfe betrieben (Meister), waren ordentliche Mitglieder der Kathedrale. Sie waren Besitzer von Werkzeugen und einer Handwerkswerkstatt, in der sie gemeinsam mit Arbeitern (Lehrlingen) und Studenten arbeiteten. Um Meister zu werden, musste man nicht nur über bestimmte materielle Mittel verfügen (um eine eigene Werkstatt zu eröffnen), sondern auch eine Lehre (von 2-3 bis 7 oder sogar mehr Jahren) absolvieren und einige Zeit als Lehrling arbeiten. In der Stadt zusammengeschlossene Handwerker (Meister) strebten in der Regel das Recht an, unter der allgemeinen Aufsicht der Stadtbehörden über ihre inneren Angelegenheiten selbst zu entscheiden. Die Leitungsgremien der Stadt waren Versammlungen von Herren und Sonderbeamten, die von den Mitgliedern der Stadt gewählt, aber oft von den Stadtbehörden ernannt (oder nach ihrer Wahl genehmigt) wurden. Die Tätigkeit des Zentrums wurde in erster Linie von den Produktionsinteressen der städtischen Handwerker bestimmt. Die Ts. kämpften (nicht immer erfolgreich) für die Gründung der sogenannten. Zunftzwang, d. h. zur Anerkennung des Monopolrechts ihrer Mitglieder auf die Herstellung und den Verkauf derartiger handwerklicher Erzeugnisse innerhalb der Stadt und ihrer Umgebung. Der C. regelte auch die Herstellung und Vermarktung handwerklicher Produkte, um günstige Bedingungen für die wirtschaftliche Tätigkeit der Mitglieder des C. zu schaffen und die Konkurrenz zwischen ihnen auszuschalten; Die Werkstattordnung legte die Arbeitszeit und die Arbeitsbedingungen für Meister und Lehrlinge, die Technologie des Produktionsprozesses, Anforderungen an die Qualität der Fertigprodukte, den Ort und die Bedingungen für den Einkauf von Rohstoffen und den Verkauf von Fertigwaren, die Bedingungen und fest Bedingungen der Lehrlingsausbildung und manchmal die Anzahl der Lehrlinge und Maschinen, die jeder Meister in seiner Werkstatt haben konnte usw. Alle diese Maßnahmen waren hauptsächlich auf die Enge des Marktes und die begrenzte Nachfrage nach handwerklichen Produkten zurückzuführen, die mit der Vorherrschaft der Subsistenzlandwirtschaft verbunden waren Die Ökonomie der feudalen Gesellschaft. Trotz der Nivellierungstendenzen der Zunftordnung eröffnete die kleinteilige Warenproduktion gewisse Möglichkeiten der Eigentumsschichtung. In großen städtischen Zentren, insbesondere in Industrien, die mit der Produktion großer Mengen Kunsthandwerk für den Export verbunden sind (Florenz, Gent, Brügge), erreichte diese Schichtung bereits im 13.-14. Jahrhundert erhebliche Ausmaße. Innerhalb des C. stachen mehr und weniger wohlhabende Herren hervor. Es gab auch eine Schichtung zwischen Zentren, die Handwerker verschiedener Fachrichtungen vereinten: Einige Zentren wurden tatsächlich zu Unternehmerorganisationen, die Arbeiten an Handwerker aus anderen Zentren verteilten. Wie andere mittelalterliche Körperschaften weiteten Kirchen ihren Einfluss auf alle Aspekte des Lebens ihrer Mitglieder aus: Sie überwachten die Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln durch Handwerker, organisierten gegenseitige Hilfe und gemeinsame Feiern, fungierten als Zellen der Stadtmiliz und traten gemeinsam in religiösen Veranstaltungen auf Prozessionen usw. Jedes C. hatte ein eigenes Emblem mit der Abbildung von Werkzeugen, einem Werkstattsiegel und einer Registrierkasse. Ts. spielte eine herausragende Rolle im sozialen Kampf innerhalb der Stadt. Die C. verteidigte die Interessen breiter Schichten von Handwerkern, führte den Kampf gegen das städtische Patriarchat und übernahm in einer Reihe von Städten (normalerweise dort, wo es ein hochentwickeltes Handwerk gab, das den vorherrschenden Zweig der städtischen Wirtschaft darstellte) die Kontrolle über das Stadt (Florenz, Köln, Gent usw.). Allerdings genossen normalerweise nur die reichsten und einflussreichsten Cs die Früchte des Sieges. Spezifische Formen von C. – ihre Organisation, Funktionen usw. - waren vielfältig und veränderten sich entsprechend den Merkmalen des sozioökonomischen und politischen Systems einzelner Länder; Sie hingen auch vom wirtschaftlichen Charakter der Stadt ab (vom Vorherrschen der Industrie oder des Handels darin), von dem Industriezweig, in dem die Zunftorganisation entstand usw. Es gab große Unterschiede im Grad der Unabhängigkeit der Stadt gegenüber den städtischen Behörden und dem Staat. In einigen Fällen genossen die zentralen Behörden eine weitgehende Autonomie, in anderen standen sie unter der strengen Aufsicht städtischer oder staatlicher Behörden (in zentralisierten Staaten war die Autonomie zentralisierter Staaten enger als in dezentralisierten; in Frankreich war sie beispielsweise enger als in Deutschland). In der Anfangsphase der Entwicklung spielte die Farbe eine progressive Rolle. Sie stärkten die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Handwerker; Die Anweisungen von Ts. zur Einhaltung bestimmter Regeln der Produktionstechnik, zur Ausbildung und zu den Anforderungen an die Qualifikation von Handwerkern trugen zur Entwicklung handwerklicher Techniken und zur Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten von Handwerkern bei. Die weite Verbreitung der Farben in ihren am weitesten entwickelten Formen war eine der Hauptbedingungen für das schnelle Wirtschaftswachstum der Länder Westeuropas im 12.–14. Jahrhundert. Im 16.–18. Jahrhundert, während der Entstehung des Kapitalismus, wurden die Kapitale jedoch zu einer Bremse auf dem Weg der wirtschaftlichen Entwicklung: Durch die Unterstützung und den Schutz kleiner Handwerksbetriebe behinderten sie die Entwicklung neuer kapitalistischer Wirtschaftsformen. Die führende Rolle in der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung ging auf neue Produktionsformen über – die heimische kapitalistische Industrie und das verarbeitende Gewerbe. In dieser Zeit veränderten sich die Organisation der Zentren und ihre Funktionen erheblich. Die soziale Grenze zwischen Meistern und Lehrlingen verschärfte sich. Im Wettbewerb mit fortgeschritteneren Industrieformen versuchten die Handwerker, ihre Position zu behaupten, indem sie sich zu einer geschlossenen privilegierten Klasse entwickelten und es den Lehrlingen immer schwerer machten, Mitglieder der Werkstatt zu werden, indem sie die Höhe der Eintrittsgelder erhöhten und strenge Anforderungen an die Handwerker stellten Produkte, die der Handwerker bei seinem Eintritt in die Werkstatt herstellen musste (sog. Meisterwerke) usw.; Es gab einen Prozess der „Schließung“ oder „Schließung“ des C. Die Ausbeutung von Lehrlingen verschärfte sich. All dies führte zu einer Verschärfung des Kampfes zwischen Meistern und Lehrlingen, zur Umwandlung von Lehrlingsgewerkschaften in Kampforganisationen gegen Meister (französisch: Compagnonages). Aus Lehrlingen und Lehrlingen wurden tatsächlich Lohnarbeiter, die immer weniger echte Chancen hatten, Meister zu werden, während die reich gewordenen Zunftmeister zu Unternehmern frühkapitalistischen Typs wurden. Die Städte verloren weitgehend ihre Selbstverwaltungsrechte und waren einer ständigen, kleinlichen Kontrolle und Steuerausbeutung durch staatliche und städtische Behörden ausgesetzt. Mit der Etablierung entwickelter kapitalistischer Beziehungen, die die Anerkennung der Prinzipien des freien kapitalistischen Unternehmertums und des Wettbewerbs mit sich brachte, wurde das Zunftsystem auch in den Industrien zerstört, in denen noch eine kleine handwerkliche Produktion erhalten blieb. In Frankreich wurden die Zölibatäre 1791 während der Großen Französischen Revolution abgeschafft; in Deutschland wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts durch eine Reihe von Gesetzen sämtliche Einschränkungen der handwerklichen Tätigkeit des Bastlers abgeschafft. In den Ländern Asiens und Nordafrikas (z. B. China, Japan, Indien, Iran, arabische Länder, Osmanisches Reich), wo die wirtschaftliche Situation städtischer Handwerker im Mittelalter und in der frühen Neuzeit in vielerlei Hinsicht der wirtschaftlichen ähnelte Situation der städtischen Handwerker im feudalen Europa, es gab auch spezielle sektorale Handwerkerorganisationen (siehe Artikel Dza, Esnaf) .
Allerdings erreichten sie nicht den Entwicklungsstand westeuropäischer Länder, verfügten nicht über die gleichen Selbstverwaltungsrechte wie diese und spielten in der Geschichte ihrer Länder eine viel geringere Rolle. Zündete.: Gratsiansky N.P., Pariser Handwerksbetriebe im XIII.-XIV. Jahrhundert, Kasan, 1911: Stoklitskaya-Tereshkovich V.V., Essays zur Sozialgeschichte einer deutschen Stadt im XIV.-XV. Jahrhundert, M. - L., 1936; ihres. Das Problem der Vielfalt der mittelalterlichen Zunft im Westen und in Russland, in der Sammlung: Mittelalter, ca. 3, M., 1951; Rutenburg V.I., Essay über die Geschichte des Frühkapitalismus in Italien..., M. - L., 1951; Polyansky F. Ya., Essays zur sozioökonomischen Politik der Werkstätten in den Städten Westeuropas im 13.-15. Jahrhundert, M., 1952; Mit dort S.M., Wirtschaftliche und soziale Entwicklung der frühen Stadt (Toulouse XI-XIII Jahrhunderte), [Saratov], 1969. Siehe auch lit. bei Art. Handwerk. Yu. A. Korkhov.
C. in Russland. In verschiedenen Städten des antiken Russlands entstanden infolge der Spezialisierung des Handwerks gemeinsame Siedlungen von Handwerkern in Hunderten von Städten (siehe Hunderte von Gemeinden).
und Sloboda x ,
Es wurden Kirchen gebaut, die die Namen von Heiligen trugen, die als Förderer bestimmter Handwerksarten galten. All dies ermöglicht es uns, über die Entstehung einer Gildenorganisation in Russland zu sprechen. Im Jahr 1722 gründete und regelte Peter I. die Zunftorganisation der Handwerker, um den staatlichen Bedarf an Kunsthandwerk bestmöglich zu decken. Freie Menschen und Leibeigene, die gegen Quitrent entlassen wurden, wurden in die Kirche aufgenommen. Um das Zentrum zu betreten und den Meistertitel zu erhalten, musste eine bestimmte Qualifikationsaufgabe erfüllt werden. Die Stellung der Gesellen und Lehrlinge in Russland im 18. – frühen 20. Jahrhundert. war machtlos. Im Kapitalismus trug die zunftliche Organisationsform des Handwerks zur Willkür der Handwerksmeister bei. In Lettland und Estland entstanden Blumen im 13.–15. Jahrhundert. nach der Eroberung dieser Gebiete durch deutsche Feudalherren. Aufgrund der Tatsache, dass die städtische Bevölkerung überwiegend aus Deutschen bestand und alte Zunfttraditionen auf neuen Boden übertrugen, wiederholten die Kirchen im Baltikum die Struktur und den Charakter der Kirchen in Deutschland. In Weißrussland, der Ukraine und Litauen – in den Gebieten, die Teil des polnisch-litauischen Commonwealth waren – wurden die Kirchen auf der Grundlage des Magdeburger Gesetzes errichtet (siehe Magdeburger Gesetz). ,
den Magistraten der Stadt gewährt. Nach dem Beitritt zum Russischen Reich Ende des 18. Jahrhunderts. Die Zunftorganisation dieser Gebiete erfuhr Veränderungen hin zu engeren Beziehungen zu Zentralrussland. In Zentralasien und Transkaukasien unterschieden sich die Königreiche erheblich von den Zivilisationen Europas: Sklavenarbeit war weit verbreitet und die Autonomie der Stämme war aufgrund des Eingreifens von Feudalherren und des Staates unbedeutend. In den Seldschukenstaaten ab dem 11. Jahrhundert. Es gab geschlossene Gruppen von Handwerkern, die die Ausbildung organisierten, Studenten aufnahmen und die Arbeit regulierten. Aus dem 14. Jahrhundert Die Kirchen übernahmen die Struktur und das Ritual von Derwischgemeinschaften und militärisch-religiösen Bruderschaften. Eine Besonderheit der Kirche war der relativ freie Zugang neuer Mitglieder und die Wahrung patriarchaler Beziehungen. Die Zunftorganisation auf dem Territorium der UdSSR hörte nach 1917 auf zu existieren. Zündete.: Vollständige Gesetzessammlung des Russischen Reiches, Bd. 6 (Nr. 3708), Bd. 7 (Nr. 4624), St. Petersburg, 1830; Leshkov V.N., Essay über alte russische Gesetze zum Handwerk und zur Fabrikindustrie, „Moskvityanin“, 1852, Nr. 23; Tikhomirov M.N., Alte russische Städte, 2. Aufl., M., 1956; Lyashchenko P.I., Geschichte der Volkswirtschaft der UdSSR, 3. Aufl., Bd. 1, M., 1952; Rybakov B. A., Craft of Ancient Rus', M., 1948; Pajitnov K. A., Das Problem der Handwerksbetriebe in der Gesetzgebung des russischen Absolutismus, M., 1952; Sacharow A.M., Städte im Nordosten Russlands, XIV.-XV. Jahrhundert, 1959.
Große sowjetische Enzyklopädie. - M.: Sowjetische Enzyklopädie. 1969-1978 .
Sehen Sie, was „Workshops“ in anderen Wörterbüchern sind:
Zechin... Russische Wortbetonung
In der mittelalterlichen Gesellschaft gab es Berufsvereinigungen von Handwerkern, die kleine, wirtschaftlich unabhängige Produzenten waren. Werkstätten entstanden in der frühen Phase der mittelalterlichen Stadtbildung in Frankreich, England und Deutschland im 11. und 12. Jahrhundert. (V… … Historisches Wörterbuch
- (deutsche Zeche) Vereinigungen städtischer Handwerker (eines oder verwandter Berufe), um sicherzustellen, dass die Mitglieder des Zentralrats ein Monopol auf die Herstellung und den Verkauf von Handwerksprodukten haben. Die größte Entwicklung wurde in Westeuropa im XIII.-XIV. Jahrhundert erreicht... ... Juristisches Wörterbuch
Großes enzyklopädisches Wörterbuch
Organisierte Vereinigungen von Handwerkern, die dieselben Fertigkeiten ausüben. Zu ihren Privilegien gehört die Erlaubnis zur Ausübung des Handwerks nur denjenigen, die es bei einem Zunftmeister erlernt haben und selbst diesen Titel erhalten haben, für den sie zunächst... Wörterbuch der Fremdwörter der russischen Sprache
Vereinigungen städtischer Handwerker (gleicher oder verwandter Fachrichtungen) zum Schutz vor den Übergriffen der Feudalherren und zur Gewährleistung des Monopols der Zünfte auf die Herstellung und den Verkauf handwerklicher Produkte. Die größte Entwicklung wurde in Westeuropa erreicht... ... Enzyklopädie der Kulturwissenschaften
Zusammenschlüsse städtischer Handwerker (gleicher oder verwandter Fachrichtungen), um den Mitgliedern der Zünfte ein Monopol auf die Herstellung und den Verkauf handwerklicher Produkte zu gewähren. Die größte Entwicklung wurde im Westen erreicht. Europa im 13. und 14. Jahrhundert. Ordentliche Mitglieder der Werkstätten... ... Politikwissenschaft. Wörterbuch.
ZÜNFTE UND ZÜNDE (deutsch Gilde, Mittlerer Oberzeche-Verband), im weitesten Sinne verschiedene Arten von Körperschaften und Vereinigungen (Handels-, Berufs-, Sozial-, Religionsgemeinschaften), die gegründet wurden, um die Interessen ihrer Mitglieder zu schützen. Gilden... ... Colliers Enzyklopädie
Werkstatthäuser auf dem Grand Place in Antwerpen. XV Jahrhundert Werkstatt (über polnisch sesh von mittelhochdeutsch zесch, zесhe „Vereinigung von Personen der gleichen Klasse“, neudeutsch Zunft) eine Handels- und Handwerksgesellschaft, die Handwerker einer oder mehrerer ähnlicher ... ... Wikipedia vereinte
Werkstätten- in der mittelalterlichen Gesellschaft Berufsvereinigungen von Handwerkern, die kleine, wirtschaftlich unabhängige Produzenten waren. Werkstätten entstanden in der frühen Phase der mittelalterlichen Stadtbildung in Frankreich, England und Deutschland im 11.-12. Jahrhundert. (,); ... Enzyklopädisches Wörterbuch der Weltgeschichte
Vereinigungen, die auf den Berufen von Handwerkern basierten, die kleine, wirtschaftlich unabhängige Produzenten in feudalen Städten waren. Gesellschaft. In der Geschichte Wissenschaftsdauer Damals wurde der Begriff Ts. nur in Bezug auf die westliche Geschichte verwendet. und Zentrum. Europa, wo C.... ... Sowjetische historische Enzyklopädie
Bücher
- Florentinische Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 13.-14. Jahrhunderts. Granden und Popolaner, „gute“ Kaufleute und Ritter, Irina Aleksandrovna Krasnova, Das Buch untersucht den Prozess der Transformation der sozialen Beziehungen in der kommunalen Gesellschaft von Florenz im 13.-14. Jahrhundert. und ein besonderer Aspekt davon sticht hervor - die Urbanisierung der alten Familien des feudalen Adels,... Kategorie:
Handwerk ist eine Art industrieller Arbeit, die besondere Kenntnisse erfordert. Stufen
Entwicklung:
a) im Haushalt des Meisters oder für die Dorfgemeinschaft arbeiten
b) Produktion zum Zwecke des Geldverdienens
Wir betrachten nur die zweite Stufe.
Bedingungen für die Einbeziehung eines Handwerkers in die Produktion für andere
1) Ein professioneller Arbeiter bringt die Produkte seiner Arbeit selbst auf den Markt => er besitzt die notwendigen Produktionsmittel oder sie werden ihm von einer speziellen Organisation: einer Werkstatt, zur Verfügung gestellt
2) Ein Berufssklave bringt nur seine Sklavenmacht auf den Markt, nicht jedoch das Produkt seiner Funktionsweise
3) Handwerksarbeiten auf Bestellung: a) freie Produktion auf Bestellung (eigene Produktionsanlagen) b) Lohnproduktion auf Bestellung (Rohstoffe oder Werkzeuge - Kunde) Das Verhältnis des Arbeiters zum Arbeitsplatz: 1) Synkretismus des Arbeitsplatzes und Zuhause 2) ein Arbeitsplatz außerhalb des Hauses (Zeitarbeit). Vollständige Trennung des Arbeitsplatzes vom Zuhause, nur im Fabriksystem. Um die Bedeutung der zweiten Stufe in der Entstehung des Fabriksystems zu analysieren, betrachten wir eine wichtige Institution des Mittelalters: die Zunft – eine Vereinigung von Handwerkern, die durch die Natur ihres Berufs geschaffen wurde. Blütezeit: 12.–15. Jahrhundert. Die Workshops sind kostenlos und untergeordnet.
Der Zweck der Werkstatt besteht darin, ihre Mitglieder durch die Bereitstellung von Lebensbedingungen und beruflichen Aktivitäten zu unterstützen. Der Nutzen ist nicht das dominierende Ergebnis der Aktivität. Das Hauptziel besteht darin, die Bedürfnisse der Workshop-Mitglieder zu befriedigen. Arbeitsorganisation: kommunal: egalitär und traditionell. Die Werkstatt verhinderte eine Spezialisierung, weil Er befürchtete, dass diejenigen, die der Produktion des Endprodukts und damit dem Markt am nächsten stehen, den Rest wirtschaftlich unterwerfen würden. Eine Werkstatt ist ein Meer von Vorschriften, die darauf abzielen, die Monopolstellung dieser Werkstatt auf dem Markt aufrechtzuerhalten und die Einnahmen auszugleichen, um allen Mitgliedern ein gleiches Konsumniveau zu gewährleisten. Die Außenpolitik der Werkstatt ist die Politik der Monopole. Die Werkstatt entscheidet über alle Produktions- und Vermarktungsfragen und das Fischereigericht liegt in ihren Händen. Die Zünfte bekämpften einzelne Handwerker und zwangen sie, sich ihren Reihen anzuschließen, und sie taten ihr Bestes, um die Aktivitäten der „Saisonarbeiter“ zu behindern. Werkstatt = ORT-Schutz, aber Fortschrittsbremse
Arten von Workshops:
1) liturgische Werkstätten: Werkstätten, die unfreie Arbeit zur Befriedigung der Bedürfnisse ihres Besitzers einsetzen, verschwinden nach der Einführung von Geldsteuern (Ägypten)
2) Ritualwerkstätten (Kasten) – Indien
3) Werkstätten als freiwillige Vereinigungen
Möglichkeiten zur Gründung von Werkstattorganisationen:
1) Der Herr organisierte die Handwerker seiner Stadt – was nicht sehr üblich ist
2) Das Anwesen bildete eine Schicht haushaltsfreier Handwerker und
Community-Verbindungen
Ein wichtiger Punkt bei der Gestaltung von Werkstätten ist die antike Kultur
bewegte sich von der Küste ins Innere des Festlandes, wo im Auftauchen
In den Städten waren spezialisierte Handwerkskräfte konzentriert.
Abhängige Handwerker eilen in die Stadt, wo ihnen die Werkstatt Schutz gewährt =>
Werkstattzerstörer des kommunalen Synkretismus. Doch die Werkstätten konnten nicht widerstehen
die Entstehung der Knechtschaft – die Abhängigkeit des Handwerkers vom Kaufmann. Kabale
entwickelt durch ein System aus Einkauf und Hausaufgaben.
Das Einkaufssystem basierte auf der besonderen Rolle des Rohstofflieferanten und
Käufer von Fertigprodukten. Die Werkstätten wurden von beiden abhängig
Händler-Importeure von Rohstoffen oder Händler-Exporteure ihrer Produkte, da diese
Waren Monopolisten auf diesen Märkten, sind sie viel besser
waren im Vertriebsbereich ausgerichtet als die Werkstätten.
Homework ist eine Arbeitsorganisation, bei der der Kaufmann als Arbeitgeber auftritt. Der Werkstattmeister ist auch ein Lohnarbeiter, denn... hing vom Händler ab, der Rohstoffe lieferte und die Produkte zum Verkauf anbot. Dadurch entstanden Netzwerke von Werkstätten und Familienwerkstätten, verbunden durch ein Netz von Handelsbeziehungen unter der Leitung eines Kaufmanns. Bei der Organisation von Produktionsketten ließ sich der Kaufmann von zwei Grundsätzen leiten: der Auswahl von Produktionseinheiten mit höchster Produktqualität und dem Wunsch nach Einheitlichkeit der Waren. Beide Prinzipien waren vom Streben nach Gewinnmaximierung bestimmt. Durch das zweite Prinzip verschwand das Einkaufssystem nach und nach und wurde zu Hausaufgaben, weil Heimarbeit zeichnet sich durch ein höheres Maß an Kontrolle über die Produktion aus => es ist für einen Händler einfacher, die Gleichmäßigkeit der Produktqualität zu überwachen. In China und Indien verhinderten traditionelle kommunale und Kastenbeziehungen das Eindringen von Kapital in die handwerkliche Produktion. Es gab andere Möglichkeiten des Kaufmannseinflusses auf das Zunfthandwerk:
Der Kapitän wird trotz der Charta zum Kaufmann (Englisch)
Eine Werkstatt, die reich geworden ist, unterwirft andere – eine Seltenheit
So entwickelte sich beim Kauf von Kapital eine Spezialisierung durch das Einkaufssystem und Heimarbeit; Schaffung von Handelsnetzwerken, über die Halbfabrikate und Endprodukte transportiert wurden; Die durch die Statuten der Werkstätten festgelegten Klassenbeschränkungen wurden ausgehöhlt und Lohnarbeiter gebildet, obwohl die Form der Einstellung noch nicht kapitalistisch war.